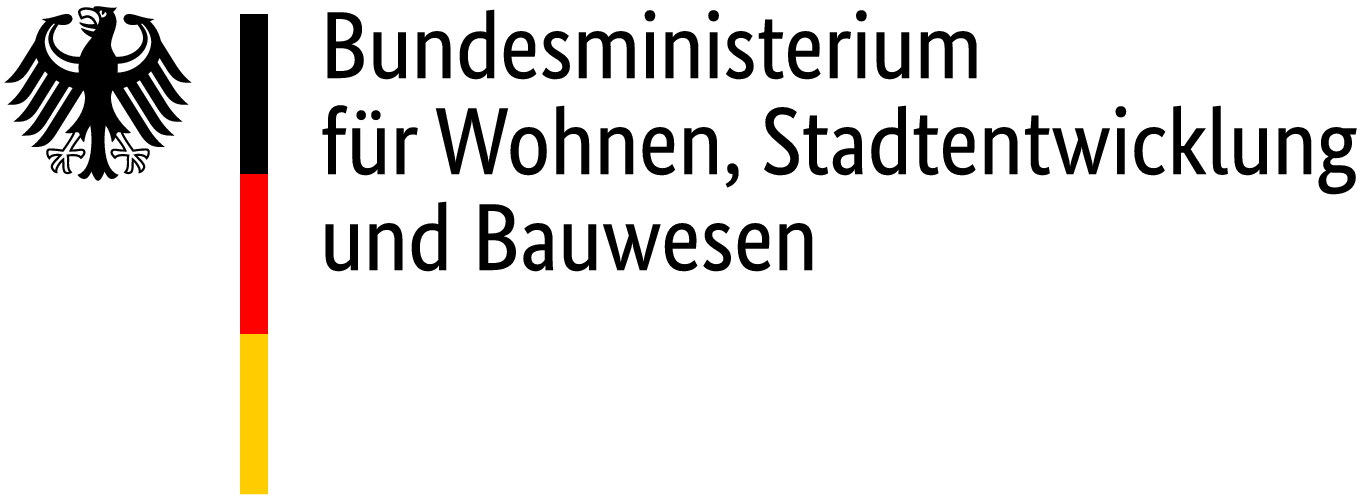Ortsteil Dissenchen/Schlichow, Cottbus , Brandenburg
Beschreibung
Anlass war 2015 die Umsetzung von Eidechsenhabitaten auf den Aussichtspunkt „Schlichower Höhe“, direkt am Ortseingang. Bei einem „Informativen Spaziergang“ des Fördervereins Cottbuser Ostsee e. V. im Mai 2016 sahen die Teilnehmer den ungepflegten Zustand, eine Schutzhütte ohne Dach, die schulischen Projekte waren verschwunden oder kaum noch zu erkennen. Dazu kamen nun Stein- und Totholzhaufen und niemand wusste, dass aufgrund der geschützten Tiere auch die Mäharbeiten eingeschränkt waren. Dieser Anblick vor Gästen war die Initialzündung für uns Einwohner von Schlichow, in Aktion zu treten.
Die Stadtverwaltung erklärte, kein Geld für Schilder mit Erklärungen zu haben, gab aber dem „Schlichower Bürgerverein e.V.“ grünes Licht für die Beschaffung von Fördermitteln. Dazu wurde 2017 eine Kooperationsvereinbarung mit dem Fachbereich Umwelt und Natur geschlossen und der Arbeitstitel „Naturerlebnisse auf der Schlichower Höhe“ gewählt. Der NABU Regionalverband unterstützte fachlich und auch die Umweltschule Dissenchen hatte Mitspracherecht bei der Gestaltung.
Das Monitoring des NABU ergab, dass hier ein einzigartiges Biotop entstanden war (120 verschiedene Blühpflanzen, über 30 Brutvogelarten und eine lange Liste von Insekten). Wir bildeten ein Team, um ein Entwicklungskonzept zu schreiben. Projektleiterin war und ist Christine Sidon.
Wir wollen
-die Artenvielfalt erhalten und schützen,
-die Aussicht auf den entstehenden „ Cottbuser Ostsee“ attraktiv gestalten,
-Cottbuser Familien Erholung in der Natur, mit sportlicher Betätigung und Naturbeobachtung ermöglichen und
-für die Schule endlich ein „grünes Klassenzimmer“ schaffen.
Wir wollen zeigen, dass Naturschutz und Tourismus vereinbar sind und unseren Ortseingang zu einem attraktiven Ausflugsziel machen.
Um die Ideen zu realisieren brauchen wir Geld, handwerkliches Geschick und viele Helfer. Deshalb haben wir uns hier für die Kategorie „Bau“ entschieden.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Stadtteil Frauenland, Würzburg, Bayern
Beschreibung
Am Hubland entsteht Würzburgs neuer zukunftsweisender Stadtteil. Der Abzug der Amerikaner aus der ehemaligen Kaserne „Leighton-Barracks“ im Jahr 2008 war für Würzburg die Chance, eine brachgefallene Militärfläche wieder zu nutzen und dort einen offenen, lebendigen Stadtteil zu schaffen.
Seine zeitgemäße Architektur verbindet innovative Bauformen mit aktuellen Baustandards wie z.B. bei der Energieeffizienz und beim Ressourcenschutz. Die vorausschauende Planung mit größtmöglicher Barrierefreiheit ermöglicht einen Stadtteil für alle Generationen. Verschiedene öffentliche und soziale Infrastrukturen sowie weitläufige Grünanlagen stehen von Anfang an den Bewohner*innen zur Verfügung und schaffen eine hohe Wohn- und Aufenthaltsqualität.
Ziel ist es, einen vielfältigen Stadtteil zum Wohnen, Arbeiten, Erholen, Einkaufen und Studieren zu entwickeln, einen lebendigen Campus anzulegen, aber auch attraktive Freiräume zu gestalten, die stadtverträgliche Mobilität zu fördern und bei allem eine qualitätsvolle Umsetzung zu sichern.
Die Bayerische Landesgartenschau 2018 war Impuls und Motor der Entwicklung. Sie beförderte einen zielgerichteten, zügigen und stringenten Prozess der Stadtentwicklung und zugleich ein Bewusstsein für eine zukunftsfähige Gestaltung.
Bereits zur Landesgartenschau war der überwiegende Teil des Geländes neu erschlossen und die ersten Bewohner*innen leben rund um das neue grüne Herz.
„Wo die Ideen wachsen“. Dieses Motto war und ist Programm sowohl für die LGS als auch für den gesamten neuen Stadtteil.
Auf dem städtischen Konversionsgelände wurden durch die LGS hochwertige Parkanlagen von ca. 21 ha angelegt.
Das Konzept Stadtgrün Hubland berücksichtigt die vorhandenen Grünstrukturen und Kaltluftschneisen zur Verbesserung des Stadtklimas, bildet Trittstufen in regionale Grünverbindungen und zeichnet sich in der Planung und Umsetzung durch eine integrative Zusammenarbeit der unterschiedlichsten Fachbereiche aus.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Iburg, Bad Iburg, Niedersachsen
Beschreibung
Zur Gewährleistung unserer Prädikatisierung als Kneipp-Kurort wurden das Schlossumfeld, der Kneipp-Erlebnispark, der Charlottenseepark und der Waldkurpark mit den Blütenterrasen umgestaltet und attraktiviert. Ergänzt werden diese Maßnahmen durch die Erlebbarmachung der Tegelwiese, die als Hochwasserrückhaltebecken dient und bewusst rücksichtsvoll zugänglich gemacht werden sollte. Anlass war die Reprädikatisierung 2010 als Kneipp-Kurort mit Auflagen zur Erhaltung des Prädikates. Beginnend mit einem Masterplan für das Schlossumfeld sind umfangreiche Baumaßnahmen umgesetzt worden, die darin mündeten, dass 2018 die Landesgartenschau in Bad Iburg stattfinden konnte. In diesen acht Jahren sind mit Unterstützung von Landschaftsplanungsbüros attraktive öffentlich zugängliche Grünanlagen entstanden, die den Kurort insgesamt aufwerten. Ergänzt wird das Angebot um den Baumwipfelpfad, der neben dem Schloss nunmehr unser Alleinstellungsmerkmal ist und dazu beiträgt, dass die städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen nachhaltig bleiben. Ziel ist nebem dem Erhalt des Kurort-Status auch die Schaffung von attraktiven Erholungsflächen für die Bad Iburger Bürger und Gäste und damit auch die Stärkung des Tourismus. Die Projektkategorie gebaut wurde gewählt, da nach den Planungen umfangreiche Baumaßnahmen stattgefunden haben. Es gab vorher lediglich den Charlottenseepark, die nicht zugängliche Tegelwiese und einen veralteten Waldkurpark. Durch bauliche Maßnahmen entstand der Kneipp-Erlebnispark, das Schloss wurde wieder sichtbar und durch veränderte Wegebeziehungen besser erreichbar, die Blütenterrassen sind ebenso wie der Baumwipfelpfad neu gebaut worden. Der Waldkurpark ist generalüberholt worden. Parkplätze und Straßen sind neu baulich angelegt worden. Ferner ist dafür Sorge getragen worden, dass das Gelände trotz der bewegten Topographie Bad Iburgs barrierefrei / barrierearm zugänglich gemacht werden konnte.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Stadtmitte, Stadt Ulm, Baden-Württemberg
Beschreibung
In den letzten Jahren hatte die Gestaltung des öffentlichen Raumes in der Innenstadt Ulms bei den städtischen Planungen hohe Priorität. Auf der Grundlage eines Plätzekonzeptes und des Verkehrsentwicklungsplans wurde das Projekt “Aufwertung Innenstadt” durch Umgestaltung der Straßen und Gassen in verkehrsberuhigte Zonen mit hochwertiger Ausstattung Schritt für Schritt umgesetzt. Mit der Neugestaltung des Münsterplatzes, dem Großprojekt “Neue Mitte Ulm” und der bevorstehenden Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes haben/werden bedeutende Stadtplätze eine an der Nutzung und den Ansprüchen der Stadtgesellschaft angemessene Gestaltung erhalten.
Neben der urbanen Stadtgestaltung soll das Thema der grünen Freiräume mit blühender Bepflanzung in der historischen Innenstadt weiter gestärkt werden.
Sieben hochwertig gestaltete, kleine Stadtgärten konnten bisher den Menschen in der Stadt als Raum für Erholung, Rückzug aber auch soziale Interaktion zur Verfügung gestellt werden. Mit den Zielen, die Anziehungskraft der Innenstadt Ulms weiterhin zu steigern, das Wohnen in der Stadt zu fördern und sinnliche Gartenkultur erlebbar zu machen, wurden diese „grünen Zimmer“ der Stadt als Kontrapunkt zum eher steinernen öffentlichen Raum der mittelalterlichen Stadtstruktur realisiert. Rund um das Münster blühen damit in der historischen Innenstadt Ulms kleine grüne Oasen auf, die sowohl den städtischen Bewohnern als auch den Besuchern eine Pause im Grünen ermöglichen. Dazu wurden Restgrundstücke, Hinterhöfe und städtische Freiflächen, die bisher in ihrer öffentlichen Wirkung unbeachtet waren, zu öffentlichen Stadtgärten umgestaltet.
Beginnend mit dem Projekt Stadtgarten “Hinter dem Brot” im Jahr 2008 konnten zuletzt 2019 im Sanierungsgebiet Wengenviertel die Stadtgärten “Auf dem Graben” und “Irrgängle” realisiert und den Ulmer Bürgern und Bürgerinnen übergeben werden.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Leipzig- Schönefeld, Stadt Leipzig, Sachsen
Beschreibung
Ziel des Projektes war es, mit einem neuen öffentlichen Quartierspark das ehemalige Plattenbaugebiet in Schönefeld an der Volksgartenstraße für alle Anwohner und Besucher wieder attraktiver und lebenswerter zu gestalten.
Kernstück des neuen 6350m² umfassenden parkartigen Grünzuges ist eine nach dem Abriss eines Punkthochhauses verbliebene Brachfläche, welche die Chance auf eine großzügig wirkende Freiflächengestaltung mit mehreren Spiel- und Freizeitsportbereichen für Jung und Alt im Grünen bot.
Gemeinsam mit dem angrenzenden offenen Jugendfreizeittreff “Kirsche”, den beiden örtlichen Bürgervereinen, dem Twio X e.V. Leipzig Parkour wurden stufenweise die Ideen für die Spiel- und Freizeitangebote entwickelt. Geplant und gebaut wurden auf rund 6350m²Freifläche eine Parkour- Trainingsanlage, ein Ballspielfeld für den Freizeitreff und zur öffentlichen Nutzung, Sandspielplatz, ein Schachfeld, eine Tischtennisplatte, ein Kinderspielplatz mit Kletterkombination und Wippe, ein Petanque- Feld ( Boule) unterschiedliche Sitzmöglichkeiten. Für das Spiel und die Erholung nutzbare , von Bäumen und Sträuchern gefasste Rasen- bzw. Wiesenflächen runden das vielfältige Angebot ab. Eine zentrale, für Fahrradfahrer und Fußgänger nutzbare Wegeverbindung führt durch den gesamten Grünzug und verbindet diesen zugleich mit den anliegenden Wohnanlagen.
Zahlreiche, neu gepflanzte Bäume und Sträucher bieten nun mehr Lebensraum für Tiere und Pflanzen und damit auch für die Anwohner Möglichkeiten Natur inmitten der Stadt zu erleben.
Mit dem Projekt konnte den aktuellen Forderungen aus Bürgerschaft und Politik, dem Stadtratsbeschluss für das Integrierte Stadtteilentwicklungskonzept 2012 als Handlungsschwerpunkt der Stadterneuerung entsprochen werden. Mit den für das Aufwertungsgebiet Schönefeld beantragten Fördermitteln Stadtumbau Ost wurde so aus einer Brachfläche inmitten eines dichten Wohngebietes ein neuer, inzwischen viel besuchter Quartierspark.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Welzow, Brandenburg
Beschreibung
Das Projekt “Gleispromenade Welzow” wurde im Zuge der Landschaftsgestaltung des Welzower Bergmannsparks zwischen dem Welzower Stadtgebiet und dem östlich an Welzow vorbeischwenkenden Tagebau Welzow-Süd entwickelt. Im Kern ging es dabei um die Entwicklung eines städtischen Naherholungsbereiches als Ersatz für, durch den Tagebau temporär in Anspruch genommene Landschaft.
Mit der Gleispromenade soll das gesamte Areal zum einen für Radfahrer und Fußgänger aber auch als Reitweg erschlossen werden. Zugleich bietet die Promenade mittels Gestaltungselementen eine Aufenthaltsfunktion, u.a. durch eine Fitnessstation sowie ein Skaterareal und wirkt identitätsstiftend. Dazu wurden neben Relikten aus dem Bergbau, die auf die 150-jährige Bergbautradition der Stadt verweisen, auf 7 Infostelen aus Cortenstahl, interessante Informationen zur Stadtgeschichte und zur Geschichte des Braunkohlenbergbaus integriert.
Das Highlight und mittlerweile ein beliebtes Fotomotiv nicht nur bei Touristen ist das ca. 12 m hohe Schaufelrad des ehemaligen Vorschnittbaggers SRs 2400/1481, welches als besonderes Gestaltungselement am Beginn der Gleispromenade errichtet wurde.
Die Gleispromenade selbst trägt ihren Namen nicht ohne Grund, denn ihr heutiger Verlauf bildet das ehemalige Gleisbett der einstigen Kohlebahn durch Welzow, auf welcher die Rohbraunkohle zu den Brikettfabriken im Ort transportiert wurde. Die Gleise wurden jedoch in den 1990er Jahren zurückgebaut, so dass der einstige Trassenverlauf zunehmend verwilderte und einen unattraktiven Anblick im Stadtgebiet bot.
Mit der Integration eines neuen Gleises für eine touristische Kleinbahn behält die Gleispromenade auch heute ihre Funktion. Ziel ist es, in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Verein Feuerwehrmuseum Welzow e.V. ab dem Jahr 2020 eine Kleinbahn auf einer Länge von etwa 1 km als touristische Attraktion für technikbegeisterte Besucher fahren zu lassen. Dazu laufen aktuell noch letzte Vorbereitungen sowie das Zulassungsverfahren.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Ursensollen, Ursensollen, Bayern
Beschreibung
Der Neubau eines Planetariums mit integrierter Sternwarte wurde in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Volkssternwarte Amberg-Ursensollen e.V. im Außenbereich der Ortschaft Ursensollen errichtet. Ausgangslage beim Bau des neuen Planetariums war, zur Förderung des Tourismus im Bereich des Naturparks Hirschwald und des Landkreises Amberg-Sulzbach beizutragen. Das Planetarium dient weiterhin zum Erhalt, vor allem zur Verbesserung der Infrastruktur der Jugendarbeit im Landkreis. Ein Planetarium mit integrierter Sternwarte benötigt ein Grundstück, das wenig bis keine Lichtverschmutzung aufweist und einen perfekten Weitblick ins Weltall bietet. Daher war es für die Verantwortlichen wichtig, dass sich der Baukörper in die angrenzende Umgebung einfügt und neben dem Bildungsgebäude auch neuer Lebensraum für Flora und Fauna entstehen kann. Das Grundstück befindet sich auf einer Lichtung, umrahmt von Mischwald. Das eingeschossige, öffnungslose Gebäude wurde mit Holz verschalt und wurde optisch einer kulturhistorischen Feldscheune nachempfunden. Die Dachfläche wurde als Flachdach ausgebildet und extensiv begrünt. Entlang der Zufahrt zum Planetarium entstanden zehn Parkplätze für das Personal des Planetariums. Diese liegen zwischen Obstbäumen, denn die Freifläche nördlich des Planetariums wurde als Streuobstwiese angelegt. An der bestehenden Hecke auf der Böschungsoberkante wurden ökologisch wertvolle Strukturen in Form von Lesesteinhaufen, Sand- und Schotterflächen und abgelagertem Totholz geschaffen. Die übrige Fläche wurde als Blumenwiese angesät und durch die Nutzung ohne Düngung und Mahd ausgehagert. Aufgrund der Lage des Grundstückes auf einer Waldlichtung und der Bepflanzung mit Streuobstbäumen fügt sich das Vorhaben in das nähere Natur- und Landschaftsbild ein. Nachdem es sich um eine neu angelegte Fläche handelt, entschieden wir uns für die Projektkategorie “gebaut”.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Sommerwaldsiedlung, 66953 Pirmasens, Am Sommerwald, Rheinland-Pfalz
Beschreibung
Bei dem Projekt handelt es sich um eine öffentliche Grünfläche, mit historischem Hintergrund für den Stadtteil “Am Sommerwald”, der bewusst in die Planung mit einbezogen wurde. Die ersten Siedler beweideten einst die Fläche mit Ihren Ziegen und bewirtschafteten den benachbarten Steinbruch. Ein Denkmal vor Ort weist darauf hin. Ziel bei dem Projekt war die Umsetzung im Rahmen der verwaltungsintern verankerten Spielleitplanung (SLP) und des GrünLabels durch: durchgehende Beteiligung der Kinder und Bürger, Gestaltung der Fläche nach den Bedürfnissen aller Nutzergruppen, extensive Pflege und Biodiversität. Das Projekt wurde „aus der Sicht der Kinder“ geplant und umgesetzt. Ablauf der SLP: Bedarfsermittlung eines Spielplatzes für den Stadtteil Sommerwald, Beteiligung der Kinder, Streifzüge, Planungswerkstatt, Modellbau, Rückkoppelung, politischer Beschluss, Mitbau vor Ort, Pflanzaktion, Beteiligung der Senioren u. Bürger über Multiplikatoren. Qualitätsziele: Nachhaltigkeit, naturnahe Gestaltungselemente wie Holz, Stein, Grün, aktive Spiel- u. Sportbereiche, Schulung der Sinneswahrnehmung (Blüh- u. Duftsträucher, Balancierelemente), Ruhe- u. Rückzugsbereiche, Biodiversität, Naturpädagogik, extensive Pflege. Die Fläche wurde Deshalb wurde das Projekt schwerpunktmäßig unter der Kategorie “gebaut” eingeordnet u. für alle Generationen, mit Spielplatz, Bolzplatz, Fahrrad-Parcours sowie Chill-Zonen gestaltet. Dennoch bestehen Synergien zu den Kategorien “gepflegt”, “genutzt”, “gemanagt”.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Orstaschaft Bassen, Gemeine Oyten, Niedersachsen
Beschreibung
Wir sind eine Gruppe von Rentnern, die in der Gemeinde Oyten ehrenamtlich Biotope anlegt und pflegt. In diesem Sinne sind wir ständig auf der Suche nach geeigneten Objekten. Nach einer Berichterstattung über unsere Aktivitäten im Gemeinderat, hat uns die Volksbank Oyten ein entsprechendes Grundstück angeboten. Dies wurde der Gemeinde übertragen und uns zur Verfügung gestellt. Unsere Zielsetzung war es, nachhaltig ein Gebiet zu schaffen, welches einen Rückzugsort für die vorhandene Tierwelt bietet und auch der Artenvielfalt dient. Darüber hinaus möchten wir Jugendliche für das Thema Naturschutz begeistern. Dazu haben wir auf der vorhandenen Wiese eine Blühfläche von ca. 880 qm angelegt, vierzig alte Obstsorten gepflanzt und eine Hecke aus heimischen Pflanzen angelegt. Inzwischen haben wir mit Auszubildenden ortsansässiger Firmen eine Sitzgruppe, bestehend aus zwei Bänken und einem Tisch, auf dem Gelände aufgestellt. Wir bieten Besuchern die Gelegenheit an dem Ort zu verweilen und die Anlage zu geniessen. Als Lebensraum für Reptilien und Insekten haben wir einen Totholzhaufen und einen Lesesteinhaufen vorgesehen. Der Totholzhaufen ist bereits fertiggestellt, den Lesesteinhaufen werden wir in der nächsten Zeit errichten. Als nächsten Schritt haben wir geplant, gemeinsam mit der örtlichen IGS eine Schülerfirma zu gründen. Ziel ist die Pflege der Anlage und das Ernten und Vermarkten der Früchte. Erste Gespräche hierzu wurden bereits geführt. Ggf. können auch noch weitere, in der Gemeinde vorhandene Obstflächen mit einbezogen werden.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Friedhöfe der Stadt Ulm, Baden-Württemberg
Beschreibung
Aus Kostengründen für die Hinterbliebenen hat sich die Stadt Ulm für die Bestattung in Urnengemeinschaftsanlagen sowie in Baumgräbern entschieden. Die Bestattung im Baum Grab kann sowohl anonym als auch in einem Baum Grab mit Stele erfolgen. Vorteil von einem Baum Grab mit Stele ist, dass dies sehr kostengünstig angeboten werden kann. Des Weiteren fällt für die Hinterbliebenen keinerlei Pflegeaufwand an. Die komplette Pflege wird durch die Friedhofsverwaltung übernommen. Dies ist vor allem für ältere Menschen von Vorteil. Im Gegensatz zur anonymen Baumbestattung bietet sich hier für die Hinterbliebenen ein Platz zum Trauern. Durch die an den Stelen angebrachten Metallschilder, mit Vorname, Name, Geburts- und Sterbedatum, ist jederzeit ersichtlich, wer dort begraben ist.
Die Grabanlage “Unter den Linden” wurde ebenfalls als Urnengemeinschaftsanlage angelegt. Auch hier ist den Hinterbliebenen genau bekannt, wo die Urne des Verstorbenen beigesetzt wurde. Der Vor- Nachname werden in die kleinen Stelen durch einen Steinmetz eingraviert.
Eine weitere Urnengemeinschaftsanlage wurde erst im Dezember 2019 fertiggestellt. Sie besteht aus acht Steinstelen und bietet Platz für 100 Urnen. Durch die an den Stelen angebrachten Metallschildern ist jederzeit ersichtlich, wer dort begraben ist. Der fehlende Pflegeaufwand für die Hinterbliebenen ist auch hier von Vorteil.
Weiterhin wurden aus Platzgründen zwei weitere Urnengemeinschaftsanlagen erstellt. Im “Garten der Erinnerung” wird den Hinterbliebenen ebenfalls ein Platz zum Trauern geboten. Diese Urnengräber werden ebenfalls, im Gegensatz zur anonymen Baumbestattung, mit Metallschildern gekennzeichnet. Auch diese Grabanlage wird komplett von der Friedhofsverwaltung gepflegt. Alle vorgestellten Urnengemeinschaftsanlagen bieten den Hinterbliebenen ein Platz zum trauern, werden durch die Friedhofsverwaltung gepflegt, und werden für die Ruhezeit von 18-20 Jahren zu einem günstigen bis akzeptablen Preis angeboten.
Steckbrief der Einreichung (PDF)