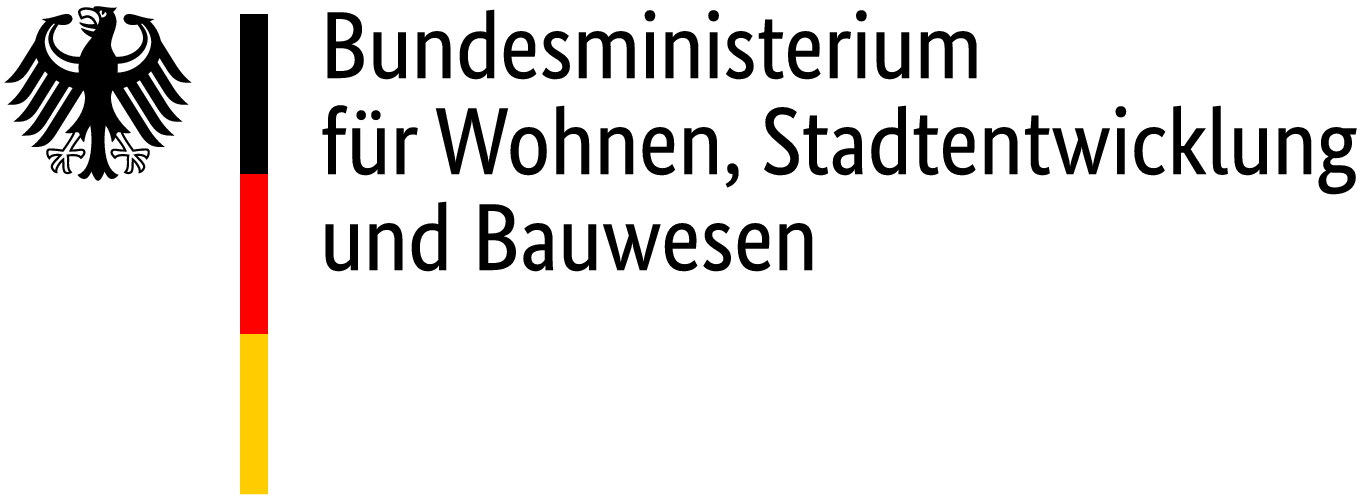Gemeinde Fehrbellin OT Protzen, Brandenburg
Beschreibung
Der Park in Protzen existiert seit dem Jahr 1753 und gehörte zum damaligen Herrenhaus. Das Gutshaus diente erst als Wohnhaus und danach als Schule. Nachdem der Schulbetrieb eingestellt wurde, entwickelte sich das Gutshaus zu einem Museum, das Exponate aus der Dorfgeschichte und zum Torfabbau in der Region zeigt. Der Torfabbau von 1874 bis 1892 führte knapp zu einer Verdoppelung der Einwohnerzahl. In der Neuzeit wurde das Gutshaus im Jahr 2003 zum Gemeindezentrum umgebaut. Nach dem Umbau hat sich hier der INSEL-Verein mit dem Dorf-, Torf- und Schulmuseum Protzen angesiedelt. Im Zuge der Projektarbeit des INSEL-Vereines wird hier Wissen zur ländlichen Histiorie vermittelt. Schon immer gab es einen festen Bezug zwischen Gutshaus und Park. Mit der Instandsetzung des Parks wurde ein Ort für alle Generationen geschaffen. Besucher aller Altersgruppen können sich hier über die Geschichte des Parks sowie über die Natur und Umwelt informieren. Für ältere Menschen ist der Park ein Treffpunkt sowie ein Ort der Ruhe. Allen Besuchern wird die kulturhistorische Bedeutung näher gebracht. Durch die Rekonstruktion des Parkes wurde das Lebensumfeld in Protzen wesentlich verbessert. Die Kinder aus den ortsansässigen Vereinen und Einrichtungen sowie Schulklassen aus dem Umland können sich hier Informationen zur Arbeit und zum Leben der damaligen Eigentümer sowie über die Flora und Fauna des Parkes einholen. Des Weiteren liegt Protzen am Pilgerweg Berlin – Wilsnack. Die 119 km lange Strecke führt unter anderem durch Protzen. Hier können die Pilger Kirchen, Parks und weitere Sehenswürdigkeiten in einer klimafreundlichen Umgebung erforschen.Der Park grenzt auch unmittelbar an das Luch. So wenig, wie der Begriff Luch allgemein geläufig ist, so wenig ist auch die Schönheit und Erholungsqualität jener Landschaft bekannt.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Kernstadt, Stadt Zittau, Sachsen
Beschreibung
Die bao GmbH suchte nach einem Projekt, dass vielen Bürgern zugutekommen soll und gärtnern in der Stadt sowie mehrere Aspekte, wie bürgerschaftliches Engagement, Verbesserung des Stadtklimas, sich gemeinsam für städtisches Grün engagieren und mit innovativen Ideen und Gestaltung zu einer nachhaltigen Nutzung beitragen, fördert. Die Idee – ein Tafelgarten! Hier verbindet sich dies in besonderem Maße mit sozialen Zwecken. Der Vorsitzende der Oberlausitzer Tafel war schnell begeistert. Es wird jede Unterstützung gebraucht, frisch Angebautes ist hilfreich und willkommen. Da die Tafel von den Handelsketten unterstützt wird, ist die Versorgung nach Angebot, manchmal eine „Schwemme“ oder rar. Durch den Tafelgarten wird sie stabilisiert, erweitert und ausgeglichen mit einem gesunden Angebot an einheimischen Obst und Gemüse. Die Stadt zeigte umgehend Interesse. Die bao entschied sich für das Gelände an der Äußeren Weberstraße, nahe ihrem Sitz mit den Werkstätten. Zudem besteht die Möglichkeit, das Gelände mit Fahrzeugen zu befahren (Abtransport zur Tafel). Es wurde zur kostenfreien Nutzung überlassen. Eine studentische Arbeit der Hochschule Zittau/Görlitz, FB Ökologie und Umweltschutz, brachte den Ansatz Permakultur als wissenschaftliche Grundlage für eine effiziente und nachhaltige ganzjährige Nutzung ein. Nun kam das Jobcenter ins Boot. Es gab die Genehmigung für eine Arbeitsgelegenheit. Auf einer ungeordneten Fläche an einer der Einfallstraßen der Stadt entsteht etwas vielseitig Besonderes. Mit gemeinsamer Idee und Umsetzung erfährt die Fläche unter sozialer Teilhabe eine wertvolle Nutzung. Das Stadtklima an der verkehrlich belasteten Strecke mit Willkommenswirkung freut sich. Es fühlen sich Natur mit Pflanzen und Gehölzen und auch Insekten wohl. Das angebaute Gemüse macht die Tafel glücklich. Die Bürger der Stadt erfreuen sich an der genutzten Fläche und unterstützen das Vorhaben aus vielfältiger Perspektive.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
St. Lorenz, Nürnberg, Bayern
Beschreibung
Das Projekt Essbare Altstadt Nürnberg hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern öffentliche Flächen in Gemüsebeete zu verwandeln und so ein Stück Lebensmittelproduktion mitten in der Stadt erlebbar zu machen. Die Idee für das Projekt ist aus der Gründung des Ernährungsrats Nürnberg hervorgegangen, der eine Ernährung aus der Region anstrebt und dabei eine Stadt- und Regionalentwicklung „von unten“ befördert. Zur Umsetzung hat sich die Gruppe „Essbare Stadt Nürnberg“ mit anderen lokalen Gartenprojekten BürgerInnen und AnwohnerInnen sowie der Stadt Nürnberg vernetzt und zwei Pilotflächen in der Nürnberger Altstadt geschaffen.
Wir sehen das Projekt in der Kategorie genutzt: Im Sommer 2019 entstanden ein großer Garten am Jakobsplatz (St. Lorenz) und eine Hochbeet-Fläche am Egidienplatz (St. Sebald), auf denen AnwohnerInnen und Interessierte Obst und Gemüse anbauen, sich in der Nachbarschaft vernetzen und einen grünen Aufenthaltsort im öffentlichen Raum nutzen können. Die Plätze wurden dabei in ihrer Nutzung komplett verändert: Der Garten am Jakobsplatz entstand aus einer brach liegenden Wiese, die zuvor nur von Hunden genutzt wurde und entsprechend wenig Aufenthaltsqualität für die Menschen im Viertel bot. In einem partizipativen Prozess wurde unter der Federführung einer Landschaftsarchitektin mit AnwohnerInnen und Interessierten ein öffentlicher Garten geplant und in die Realität umgesetzt.
Am Egidienplatz hat die Stadt Nürnberg vier Parkplätze zur Verfügung gestellt, auf denen urbaner Lebensmittelanbau auf versiegelten Flächen erprobt wird. Dabei wurde deutlich, wie umkämpft urbane Räume sind: während sich die einen über grüne Aufenthaltsorte in ihrem Wohnumfeld freuen, fehlen anderen wohnortnahe Parkplätze. Die entstehenden Nutzungskonflikte wurden zum Anlass genommen, BürgerInnen noch mehr an Entscheidungsprozessen zu beteiligen und in der Nachbarschaft in den Austausch darüber zu kommen, wie die Stadt jetzt und in Zukunft aussehen soll.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Stadtmitte, Völklingen, Saarland
Beschreibung
2015 Aufnahme des Quartiers “Nördliche Innenstadt”, Stadtteil mit „besonderem Entwicklungsbedarf“, in das Städtebauförderprogramm Soziale Stadt. Grundlage: Integriertes städtebaul. Entwicklungskonzept. Zeitgleich 2015-2018 Teilnahme des Gebiets am ESF-Bundesprogramm “BIWAQ – Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier” (Kooperationspartner der Stadt: Diakonisches Werk an der Saar GmbH, DW). Im Sinne der gemeinsamen Zielsetzung “Besser leben und arbeiten im Quartier” sollten mit der Idee der Schaffung eines “interkulturellen Nachbarschaftsgartens” im Handlungsfeld “Soziale u. kulturelle Infrastruktur stärken” die Ziele verfolgt werden: Stärkung von Nachbarschaften u. des Miteinanders der Kulturen, Aufwertung des Wohnumfelds, Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, Imageverbesserung u. Identitätsbildung des Wohnviertels, Grünflächen entwickeln im grünflächenarmen Quartier. Ehemaliger Pfarrgarten (ca. 900 m², im Eigentum der Kirchengemeinde) als möglicher Standort im Quartier, der schon lange nicht mehr genutzt wurde u. verwildert war, der aber direkt an das öffentlich begehbare Kirchenumfeld angrenzt. Abschluss Nutzungsvereinbarung zw. Stadt, Kirchengemeinde u. DW zur dauerhaften Absicherung der Nutzungsmöglichkeit der Fläche, der Zuständigkeiten u. Verantwortlichkeiten. Planerstellung durch Planungsbüro unter Mitwirkung potenzieller Nutzer von Anfang an, Herrichtung von Fläche und Boden, Anlegen von Wegen, Sitzmauern und Wasserzapfstellen durch die Stadt. Es wurden 16 individuell nutzbare, zueinander offene Parzellen plus Gemeinschaftsbereich geschaffen. Die Parzellen werden von den jeweiligen Nutzern in Eigenregie bewirtschaftet u. geerntet. Anleitung durch Mitarbeiter DW; Ergänzung der Infrastruktur (Unterstand, Kompost, Einfriedung u.a.) über Teilnehmende des BIWAQ Projektes (Langzeitarbeitslose). Regelmäßige Treffen aller Nutzer. Die Wieder- u. Neunutzung des Gartens ermöglicht Randgruppen im Quartier die Teilhabe am öffentlichen Leben u. Integration.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Wohngebiet "Am Bleicher" , Kraiburg a. Inn, Bayern
Beschreibung
In der Marktgemeinde Kraiburg sind die Spielplätze in die Jahre gekommen, alte Spielgeräte und verwilderte Grünflächen prägten das Bild. Eine Projektgemeinschaft formierte sich und untersuchte mit gemeinsam mit Jugendlichen die Situation. Schließlich wurde der zentrale Spielplatz am Bleicher ausgewählt, um ihn einem “Facelifting” zu unterziehen. Da kaum Budget für die Maßnahmen vorhanden war, wurden die Betriebe und Vereine der ganzen Marktgemeinde mit einbezogen – der Beginn eines beispielhaften Gemeinschaftsprojektes.
Weitgehend unentgeltlich wurden die Planungen von ARIS Architekten aus Kraiburg umgesetzt, durch zahlreiche Material- aber auch Geldspenden und an die tausend freiwillige Arbeitsstunden wurde nicht nur der Spielplatz aufgewertet und vergrößert, auch ein kleiner Mehrgenerationen-Platz entstand inmitten des alten (und neuen) Wohngebiets, zusätzlich bevölkert von neu hinzugezogenen Familien der Herzogin-Uta-Straße.
Das Gelände wurde zum Erlebnis-Park mit Hügeln, Geschicklichkeits-Parcours und “Verstecken” ummodelliert, viele Sitzgelegenheiten und ein kleines Amphitheater geschaffen. Inmitten der Grünfläche dient eine riesige Sandfläche mit neuem Brunnen und Wasserlauf als Bauplatz für die Nachwuchs-Baumeister, auf den umliegenden Sitzbänken treffen sich die Eltern und Großeltern.
Alte verrostete Spielgeräte wurden z.B. in eine Spiellokomotive von einem Zimmerer umgebaut, zusätzliche Spielgeräte konnten durch Spenden angeschafft werden, auch ein öffentliches Bücherregal wurde am Mehrgenerationenplatz installiert.
Beachtlich ist, alle Angesprochenen waren sofort bereit mitzuwirken – und das auch langfristig. So erklärte sich der Gartenbauverein z.B. nicht nur bereit, Pflanzarbeiten durchzuführen, sondern auch einen Teil der laufenden Pflege zu tragen.
Das Projekt zeigt vorbildlich, wie eine Gemeinschaft, die sich erst zusammenfinden musste, Beachtliches zustande bringt, wenn alle zusammenhelfen und wie dadurch Identifikation mit dem Ort entsteht.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Gropiusstadt, Berlin, Berlin
Beschreibung
Das Ziel des Projekts ist es, die umweltfreundliche Mobilität des Berliner Quartiers Gropiusstadt nachhaltig zu stärken und zu entwickeln. Auf Grundlage des ausgewiesenen Quartiersmanagementgebiets Gropiusstadt wird das Gebiet seit 2017 zusätzlich durch das Förderprogramm Zukunft Stadtgrün gefördert. Als Leitlinie für die Etablierung einer zukunftsfähigen und klimafreundlichen Mobilität wurde in diesem Zusammenhang ein Konzept erarbeitet, die das Verkehrsverhalten analysiert und Maßnahmen zur Verbesserung entwickelt hat. Dabei wurden bestehende Qualitäten des Stadtraums und Potenziale herausgearbeitet. Die Gropiusstadt, welche man auch als „Stadt im Park“ bezeichnen kann, ist durch großzügige Freiflächen und Wegeverbindungen abseits von Hauptverkehrsstraßen gekennzeichnet, die eine gute Ausgangsposition für die Etablierung umweltschonender und gesundheitsfördernder Mobilitätsformen bietet. Als eine erste Maßnahme und Ergebnis des Mobilitätskonzepts wurde eine Flotte an Lastenfahrrädern für das Quartier angeschafft. Die Fahrräder sollen in einem sozial gerechten Verleihsystem den Bewohnern zur Verfügung gestellt werden. Dies soll dazu beitragen die Nutzung des öffentlichen Grüns sowie die körperliche Betätigung der Bewohner zu fördern. Durch die Anschaffung barrierefrei nutzbarer Rikschas ist das Projekt zudem inklusiv. Die Projektkategorie wurde ausgewählt, da es sich um eine sozial- orientierte Maßnahme handelt, die einen wichtigen Beitrag für den Umwelt-, Klima- und Gesundheitsschutz sowie das Teilhabe leistet. Das Projekt ist dadurch im Besonderen gekennzeichnet, da es nutzer- und nicht profitorientiert agiert. So wurden die Modelle der Fahrräder gemeinsam mit Bewohnern ausgewählt, der Verleih und die Wartung wird mit einem ansässigem Verein organisiert und die Verleihoptionen sollen entsprechend den Anforderungen des Quartiers sozial gerecht gestaltet werden. Perspektivisch werden auch weitere Maßnahmen zur Förderung des Fahrradverkehrs realisiert werden.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Wangerland, Niedersachsen
Beschreibung
Das Wangerland ist in besonderer Weise von der Küstenlandschaft, einer intensiven Landwirtschaft und der Natur geprägt. Die Gemeinde ist zudem vom Tourismus abhängig, für den eine intakte Landschaft von größter Bedeutung ist. Man sollte daher meinen, dass die Forderung nach „mehr Grün“ hier nicht erforderlich wäre. Die Gemeinde ist aber auch geprägt von sehr vielen Ferienhäusern und Häusern, die als Zweitwohnsitz oder von älteren Menschen genutzt werden. Das hat zur Folge, dass aus Bequemlichkeit oder wegen häufiger Abwesenheiten der Bewohner, den Gärten teilweise wenig Beachtung geschenkt wird, sie extrem pflegeleicht gestaltet werden oder dem Trend folgend zu sogenannten “Gärten des Grauens“ verkommen. Um dieser Entwicklung nicht durch Verbote sondern durch positive, anregende Beispiele entgegenzuwirken, wurde im Rahmen der Wangerländer Aktion „Erde und Flut“ die Idee geboren, jährliche Gartenwettbewerbe auszuschreiben, in denen unterschiedlichste Gartenformen (Vorgarten, Ziergarten, Nutzgarten, Betriebsgarten, Bauerngarten, Spielgarten) vorgestellt, von einer Fachjury bewertet und einer großen Besucherzahl zugänglich gemacht werden. Diese Wettbewerbe sind zu einer festen Einrichtung geworden und erfreuen sich regerTeilnahme. Wichtig ist es, die Gestaltung von Gärten unter ökologischen Aspekten anzuregen. Es hat sich gezeigt, dass es sehr viele unterschiedliche Ideen gibt, den eigenen Garten nach eigenem Geschmack und für sehr individuelle Zielsetzungen zu gestalten. Es ist daher auch für die Jury nicht immer einfach, eine vergleichende Wertung abzugeben. Auch die Größe der Grundstücke und ihre ganz spezielle Lage spielen bei der Wertung eine große Rolle und haben es als notwendig erscheinen lassen, die Gärten in sehr unterschiedlichen Kategorien zu bewerten. Zur Unterstützung der Zielsetzung des Gartenwettbewerbes werden auch Gartenmessen veranstaltet, in denen weitere Anregungen vermittelt werden und Gelegenheit zum Pflanzentausch oder Kauf geboten wird.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Bayreuth, Bayern
Beschreibung
2013 bis 2016 entstand in der Rotmainaue im Rahmen der Landesgartenschau 2016 ein weitläufiger Landschaftspark mit Erholungs-, Hochwasserschutz- und Naturschutzfunktionen. Ziel der Baumaßnahme war es, für Bayreuth einen zusätzlichen Bürgerpark mit Landschaftscharakter, eingebunden in das Fuß- und Radwegenetz, zu schaffen. Dieser sollte das vorhandene Grünflächenangebot ergänzen, erweitern und einen Landschaftsausschnitt neu definieren. Hierzu wurde der Rote Main auf einem Abschnitt von 1,4 km renaturiert und in einen mäandrierenden Lauf gebracht. Ein 2 ha großer Auensee mit Seebühne und Schilfzonen ist neu angelegt worden. Baulich wurde das Gelände durch fünf „Gartenkabinette“ aufgewertet, von denen vier in einer neuartigen Erdbetonbauweise ausgeführt wurden. Die neu gebaute Auenpromenade verbindet diese Kabinette in einem großzügigen Bogen. Entsprechend ihrer Namensgebung enthalten diese Kabinette den Kiosk mit Veranstaltungsfläche sowie die Rasentribüne für die Seebühne („Kulturkabinett“), den Hopfengarten mit aufwändigen Staudenpflanzungen sowie das Heckentheater („Gartenkabinett“), den Bolzplatz und eine grüne Veranstaltungsfläche mit Grillplätzen („Grünes Kabinett“), das große Kletternetz mit Spielmöglichkeiten („Sportkabinett“) und den Stauden-Senkgarten mit dem Pavillon Auenblick („Panoramakabinett“). Nach Abschluss der Gartenschau stehen diese Einrichtungen für vielfältige Nutzungen zur Verfügung (ca. 170 kulturelle, sportliche oder naturkundliche Veranstaltungen pro Jahr). Die weiträumigen, mit gebietsheimischen Saatgut eingesäten Talwiesen werden zur traditionellen Heugewinnung genutzt, das gewonnene Heu innerbetrieblich im Stadtgartenamt als Tierfutter verwendet. Ein festgelegter Pflegeplan dient der Entwicklung artenreicher Biotope. Ergänzt wird das Angebot seit 2019 durch den Naturgarten des Vereins „Summer in der City e.V.“, der anhand beispielhafter Geländegestaltung Anregungen zur insektenfreundlichen Anlage privater Hausgärten gibt.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
65510 Idstein, Hessen
Beschreibung
Die Projektidee entstand aus der Stadtgesellschaft heraus, im Zuge der Planung eines anderen Grünraumprojektes durch die Stadt Idstein, des sog. Generationenpark.
Während letzterer eine große parkartige Grünfläche mit Spiel- und Freizeitanlagen ausgestattet hat, haben zwei Bürgerinnen einen ergänzenden Grünflächen-Baustein konzeptioniert, der sich dem Gedanken des Generationenübergreifenden und -verbindenden verschrieben hat: einen Gemeinschaftsgarten, der sich als “Begegnungsstätte für Kultur und Hortikultur” versteht.
Konzeptkonform stehen, neben dem praktischen gemeinschaftlichen Gärtnern, Aspekte wie Umwelt- und Ernährungsbildung durch praktisches Erleben und themenfokussierte Veranstaltungen im Mittelpunkt, um ein ganzheitliches und sinnliches Erfahren unserer belebten und unbelebten Umwelt anzubieten. Ergänzt werden diese Angebote, um Kultur und Natur harmonisch zu vereinen, durch breit gefächerte kulturelle Angebote, die die Ganzheitlichkeit der Grünraumerfahrung ergänzen und stärken.
Das Ziel war und ist, jedem ein niederschwelliges Angebot für ein Natur- und Grünraumerlebnis zu bieten, unabhängig von eigenem Garteninteresse und gärtnerischen Kenntnissen. Der Bürgergarten will erfahrbar machen, wie bedeutend ein frei zugänglicher öffentlicher Raum ohne Konsumzwang für eine demokratische und pluralistische Stadtgesellschaft ist. Die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten, die in ihm realisiert werden, um dieses Ziel zu erreichen, begründen die Bewerbung in der Kategorie “genutzt”.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Markt Hahnbach, Bayern
Beschreibung
Die Vils entspringt auf etwa 453 m ü. NN in Kleinschönbrunn (Gemeinde Freihung) und mündet bei Kallmünz in die Naab. Sie ist von großer Bedeutung für den Landkreis Amberg-Sulzbach und hat ihn sowohl landwirtschaftlich als auch wirtschaftlich geprägt. Gegenwärtig wird der Fluss zum Angeln oder Boot fahren genutzt und ist ein herrliches Naherholungsgebiet. Darüber hinaus ist die Vils ein wichtiger Lebensraum für seltene Pflanzen und Tiere (Natura 2000 Gebiet). Dieses gilt es zu schützen, aber auch für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, frei nach dem Motto “Nur was man kennt, schützt man”. Obwohl sich die Vils um den alten Ortskern von Hahnbach schlängelt und durch die westlich anschließende Bebauung jetzt mitten durch den Ort verläuft, war die Vils vor der Umsetzung des Projekts “VilsErleben” als Fluss nur von der Brücke der Bundesstraße 14 aus wahrnehmbar. Ein direkter Kontakt war aufgrund der einsäumenden Baum- und Strauchbepflanzung, sowie der ausgeprägten Hochwasser-Flutmulde nicht möglich. Ansatzpunkt für das Projekt VilsErleben war die sog. “Gocklwiese” westlichen des Ortskerns von Hahnbach. Sie als kaum strukturierte Grasfläche mit einem kleinen Skaterpark und einem kleinen Spielplatz wahrgenommen, überdies von örtlichen Vereinen ein/zwei Mal jährlich für Veranstaltungen genutzt. Ziel war die Zugängigmachung der Vils und gleichzeit einen Erholungsraum zu schaffen. So sollten neben Ufersitzstufen, ein Aussichtssteg (in Form eines Piratenboots), eine Wasserkanone, ein Wasserspielplatz, ein überdachter Aufenthaltsbereich, ein Grillplatz mit Sitz- und Brotzeitmöglichkeiten, Mehrgeneration-Fitnessgeräte, Stellplätze und abschließend ein Rundweg durch die Gocklwiese entstehen. Trotz dieser vielfältigen Nutzungen sollte auch weiterhin eine Veranstaltungsfläche für Vereine erhalten bleiben. Die Anlagen sind fertiggestellt und werden seit Sommer 2019 durch die Bevölkerung genutzt.
Steckbrief der Einreichung (PDF)