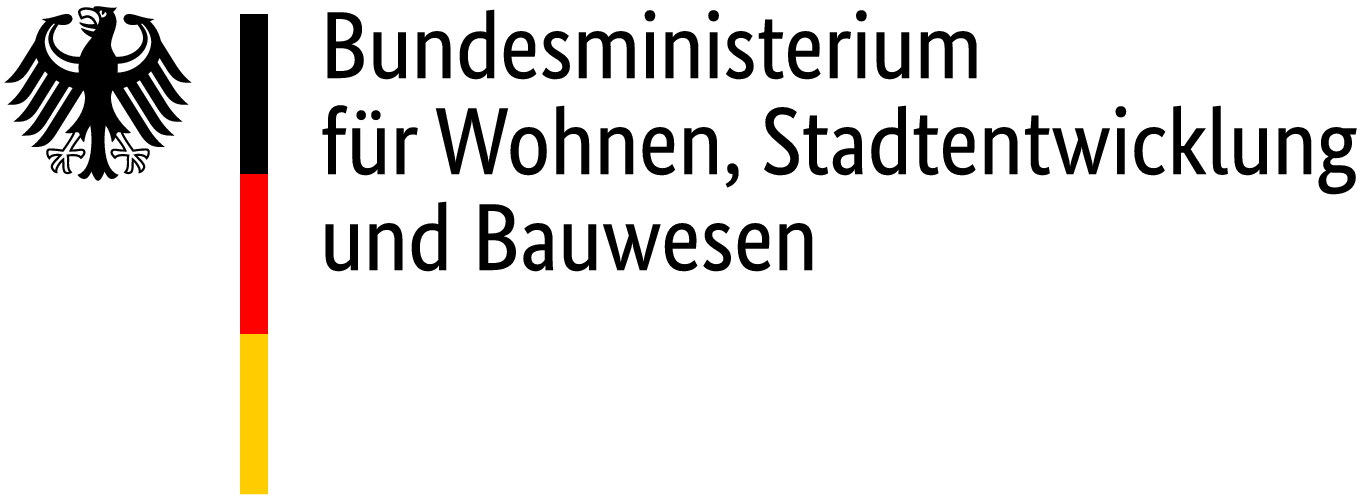Kasernenviertel, Regensburg, Bayern
Beschreibung
Im Bereich der ehemaligen Nibelungenkaserne entsteht derzeit mit ca. 13 ha der drittgrößte Park in Regensburg. Der Brixen-Park ist ein wichtiger Baustein zur Versorgung des Quartiers mit Freizeit- und Erholungsräumen. Das Parkkonzept beinhaltet drei Zonen: den Wiesenpark, den Spiel- und Sportpark und den Waldpark.
Wiesenpark
Von 2014 – 2016 wurden der 1. und 2. Bauabschnitt der Grünflächen im nördlichen Bereich des Baugebiets realisiert. Große Teile des Gehölzbestands wurden dabei erhalten und durch Neuanpflanzungen von Obstbäumen ergänzt. Neben artenreichen Wiesenflächen, die dem naturschutzrechtlichen Ausgleich dienen, wurden auch mehrere Rasenflächen im sogenannten Wiesenpark für die allgemeine Naherholung geschaffen. Optional werden Flächen für Urban Gardening angeboten. In Nachbarschaft zum Jugendzentrum Arena entstand der Bauspielplatz, der von den Regensburger Eltern betrieben und von der Stadt gefördert wird. Kinder im Alter von 8-14 Jahren können hier an 2-3 Tagen in der Woche unter pädagogischer Anleitung kostenlos kleine Spielhäuser und Möbel aus Holz selber bauen.
Spiel- und Sportpark
Im 3. Bauabschnitt wurde zwischen 2016 und 2017 der östliche Teil des Spiel- und Sportparks hergestellt, der von mehreren Spiel- und Sportflächen für Kinder- und Jugendliche geprägt ist. Für Sportliche entstanden ein Basketballplatz, Beach-Volleyballfeld und eine Boule-Fläche. Nebenan können Fitness-Begeisterte ihre Muskeln oder ihren Gleichgewichtssinn beim Bouldern oder Balancieren trainieren. Im 5. Bauabschnitt wurde der westliche Bereich des Spiel- und Sportparks mit einer Hundefreilaufzone und einem Grillplatz erstellt. Im 6. Bauabschnitt soll der erste Inklusionsspielplatz in Regensburg entstehen, der derzeit in Planung ist und 2020 – 2021 umgesetzt werden soll.
Da sich der bisher gebaute Teil des Brixen-Parks als Multitalent für unterschiedliche Nutzergruppen und als innovatives Leuchtturmprojekt erweist, kam hier nur die Kategorie “gebaut” in Frage.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Gemeinde Ganderkesee, OT Bürstel, Gemeinde Ganderkesee, Niedersachsen
Beschreibung
Bei der Erweiterung eines Gewerbegebietes wurde auch die Entscheidung getroffen, das Regenwassermanagement zu verändern. Es wurden Teile des Systems abgehangen diese Wassermengen auf eine tief liegende Fläche des Geländereliefs zu führen. Hier wurden für ein 5-jähriges, als auch für ein 100-jähriges Regenereignis die Dimensionierungsberechnung durchgeführt. Beide Fälle ergeben ein positives Prüfungsergebnis. Der Überlauf der Anlage ist über einen abführenden Graben möglich. Das weitläufige Becken ist nach den landschaftsintegrierenden Maßnahmen mit Feld- und Wallhecken noch etwa 2,2 ha groß.
Die konventionelle Pflege würde mit einer zweimal jährlichen Mahd organisiert. Die Alternative wäre eine Beweidung der Fläche. Aufgrund der unregelmäßig – regenbedingten- flächenhaften Wassereinträge ist die Eignung entsprechenden Beweidung mit herkömmlichen Tierarten nicht durchführbar. Die Alternative dazu sind Wasserbüffel, die im Landkreis Oldenburg und in der Wesermarsch inzwischen bereits an mehreren Orten gehalten werden. Der Deutsche Büffelverband spricht von mehr als 6.000 Büffeln, die mittlerweile in Deutschland gehalten werden – Tendenz steigend.
Durch die Tieflage der Fläche im Gelände geschieht die Wasserspeisung über oberflächennahe Bodenschichten. Die stauenden Lehm-Sandgemische liegen unter einer Bodenkrume von 30 cm Tiefe. Insgesamt ist die Fläche, resultierend aus der eiszeitlichen Entstehung, eine Mulde mit einigen Dezimetern Höhenunterschied. Das zusätzlich auf die Fläche geführte Regenwasser aus dem Regenwasserkanalnetz ist im Havariefall vor der Fläche einstaubar. Eine Filterung des Regenwassers bezüglich möglicher Plastikbestandteile wird im Probelauf geprüft und mittels eines Siebes gegebenenfalls zurück gehalten.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Maxvorstadt, München, Bayern
Beschreibung
Der Josephsplatz liegt an der Nordgrenze der Maxvorstadt zum Stadtbezirk Schwabing-West
Der Platz wird geprägt von der denkmalgeschützten neobarocken St. Josephskirche. Sie bildet den östlichen Abschluss des Platzes. Der Platz selbst war zweigeteilt, in eine dem Kirchenportal vorgelagerte befestigte Platzfläche und einen Quartiersgrünplatz, der als Spielplatz genutzt wurde. Auf einer befestigten Restfläche am westlichen Ende des Stadtraumes war der denkmalgeschützten Franziskusbrunnen situiert.
Die Situation am Josephsplatz war durch einen sehr hohen Verkehrsflächenanteil für den motorisierten Individualverkehr geprägt. Die Anwohner waren einer starken Belastung durch den Parkplatzsuchverkehr und damit Lärm und Abgasemissionen ausgesetzt. Zudem lag der monofunktionale Quartiersgrünplatz – wie eine Insel – inmitten von umgebenden Straßen und war für die Bewohner*innen des Stadtquartiers nur erschwert zu erreichen.
Sowohl die namensgebende St. Josephskirche und der Franzikusbrunnen als auch die angrenzenden, teilweise ebenfalls denkmalgeschützen Gebäude, lagen ohne Bindung zueinander weitestgehend isoliert am Platz. Ein räumlicher Zusammenhang – das Platzensemble ist Teil des sogenannten malerischen Städtebaus der damaligen Stadterweiterungsplanung – war nicht zu erkennen.
Durch den Bau einer Anwohnertiefgarage bestand die Möglichkeit, einen Ort für alle Menschen zu schaffen, der sowohl die umgebende Bebauung als auch die Kirche und den Franziskusbrunnen miteinander verbindet und vernetzt.
Vorhandene Straßen und Stellplätze sollten in zusammenhängende barrierefreie Fußgängerbereiche und Radverkehrsflächen umgestaltet werden. Sowohl die Monofunktionalität und die räumliche Isolation des Kirchenvorplatzes als auch die des Spielplatzes für Kleinkinder sollte zugunsten eines multifunktionalen
Quartierplatzes mit Respekt vor den Denkmälern aufgehoben werden.
Mit dem Neubau des Josephsplatzes ist eine sehr lebendiger, vielschichtiger Stadtplatz entstanden.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Ludwigsfelde – Ahrensdorfer Heide, Brandenburg
Beschreibung
Dort wo zuvor ein Acker als landwirtschaftliche Fläche genutzt wurde, entsteht ein neuer Stadtteil inklusive weiter Grünflächen. Die Planer haben dabei besonderen Wert auf die Aufenthaltsflächen gelegt. So entstand kein grüner Flickenteppich, sondern bedürfnisorientiertes Stadtgrün, das Artenschutz mit Aufenthaltsqualität in einer besonderen Weise verbindet. Vor allem die gemeinsame Nutzbarkeit von Grünflächen kommt bei den Bewohnern gut an. 440 Laubbäume, 598 Wildobstbäume (Apfel-, Birnen- und Pflaumenbäume) und 95 Straßenbäume wurden seit Baubeginn gepflanzt. Die Rasenfläche erstreckt sich über 70.000 m² Wiesenfläche aus Regionalsaatgut – bestehend aus 70% heimischen Gräsern und 30% Kräutern. Die Wiesenfläche wird durch 26.000 m² Rasenfläche ergänzt. Durch die besondere Struktur der Anlage gehen die Grenzen zwischen privaten und öffentlichen Grünflächen fließend ineinander über.
Die angelegten Streuobstwiesen werden durch die Bewohner gemeinschaftlich genutzt. Dadurch ist ein vielfältig nutzbarer grüner Raum -ergänzend zu den privaten Gärten- entstanden, der in seiner Funktionsfähigkeit als grüne Lunge, Sport-, Spiel- und Aufenthaltsfläche oder auch als Fläche für weiteren Anbau von Obst und Gemüse zur Verfügung steht. Wie die Flächen zukünftig entwickelt werden, obliegt der Entscheidung der anliegenden Bewohner, die gemeinschaftlich Eigentümer der Flächen sind. Vom Gemüsebeet, weiteren Bäumen oder Spielgeräten bis hin zur gemeinsamen Ernte der Erzeugnisse, alles ist denkbar. Ziel ist es, die soziale Interaktion im Quartier zu stärken. Die Einwohnerstatistik des Rousseau Parks zeigt, dass besonders junge Familien mit vielen Kindern dort ihr Eigenheim bauen. Kindern und Jugendlichen eröffnen der öffentliche Park, die Streuobstwiesen und eigenen Gärten die Chance, Grün in ihrer unmittelbaren Umgebung zu erleben und spielerisch erfahren zu können – und so die nötige Sensibilität für die Natur und deren Schutz auszubilden.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Schöneweide, Berlin; Treptow-Köpenick; Adlershof, Berlin
Beschreibung
Die Transformation des ehemaligen Bahngrundstücke und die Schaffung neuer Freiräume, die Nutzung und Naturschutz vereinen, war die Zielsetzung bei der Gestaltung des neuen Grünzugs Gleislinse. Auf dem Gelände des ehemaligen Rangierbahnhofes der sog. “Gleislinse” wird ein neuer Gewerbestandort entwickelt. Zwischen dem Bebauungsgebiet und den Bahngleisen liegt ein etwa 800 Meter langes grünes Band, der die nahegelegenen Parks in Johannisthal und der Köllnischen Heide miteinander verbindet. Bei der Gestaltung des Grünzugs fand der Natur- und Artenschutz besondere Berücksichtigung. Der Erhalt und die Integration von vorhandenen Habitaten für Zauneidechsen oder den seltenen Steinschmelzer waren wichtiger Teil des gestalterischen Konzepts. So orientiert sich die Gestaltung an vorhandenen Gleis- und Vegetationstrukturen. Ein zentrales Element ist der innerhalb des Grünzugs verlaufende Geh- und Radweg, welcher als wichtiger Bestandteil der übergeordneten Erschließung zwischen den Bahnhöfen Schöneweide und Adlershof sowie dem Landschaftspark Johannisthal und der Köllnischen Heide fungiert. Entlang des neuen Geh- und Radweges verläuft zur Betonung der Axialität ein breites Plattenband. Zu beiden Seiten liegen besonders schützenswerte Trockenrasenstandorte und wertvolle Habitatsflächen der Zauneidechse, die den Schotter der ehemaligen Gleisflächen als Lebensraum schätzt. Die Überreste der früheren Nutzung wurden nicht nur erhalten, sondern auch gestalterisch integriert: Aufeinander lagernde Betonschwellen dienen als rhythmisierende, gliedernde Landmarke sowie als neuer Lebensraum für die heimische Fauna. An diesen Schwellenblöcken wurde als Referenz an die vergangene Bahngeschichte im Abstand von je 100 Metern sogn. Hektometerzeichen befestigt. Am Wegesrand befindliche Infotafeln informieren den Besucher über die lebendige Geschichte des Ortes sowie die ökologische Vielfalt der Gleislinse.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Obergiesing, München, Bayern
Beschreibung
Die zentrale Giesinger Grünanlage wurde im Rahmen des Bund-Länder-Städtebauförderprogramms „die Soziale Stadt“ ausgebaut.
Die Konzeptentwicklung erfolgte im Rahmen eines umfangreichen Beteiligungsverfahrens.
Im Dialog mit dem ehemaligen AGFA-Gelände öffnet sich der Park nach Norden. Als Erkennungsmerkmal erhalten alle Zugänge Findlinge, ein vorhandenes Element. Durch Bürger angeregt, wurde als Ergänzung ein Fitnessparcours installiert.
Der Parcours ist altersübergreifend konzipiert und kann mit Slackline, Trampolin, etc. auch als Treffpunkt für Familien dienen. Über eine Zwischenzone mit Baumbestand schließt eine Dirtbikeanlage mit Pumptrack das Aktivitätsangebot ab. Unter Ausnutzung der topographischen Situation entsteht ein attraktiver Fahrradparcours.
Nach der Geländeanalyse wurde die Idee eines Spielplatzes mit dem Thema „Burgruine am Katzenbuckel“ umgesetzt. Begünstigt durch die Topographie entstand ein vielfach bespielbares „Ruinenthema“. Im Norden liegt der Burggraben, angefüllt mit Sand, der mit „Floß“ und „Brücken“ überwunden werden muss. Der Hang zur Burgmauer ist mit Rutschen und „Belagerungstreppen“ versehen. In der Burg angekommen, kann man multifunktonale Flächen, den „Burgturm“ und wilde Vegetationsflächen erkunden. Über allem steht der „Drache“, für die einen der Beschützer, für die anderen der Zerstörer der Burg.
Nach Auflösung einer Kleingartenanlage bestand die Möglichkeit, den Park abzurunden. Zur Tegernseer Landstraße wurde ein Wall geschüttet, der vorhandenes Bodenmaterial aufnimmt und Lärm- und Sichtschutz bietet. Im Winter kann er als Rodelhügel genutzt werden. Im Zentrum der Parkerweiterung entstand in Anlehnung an den Gehölzbestand eine Wiese mit nach Westen ausgerichteten großzügigen Sonnenbänken. Die hoch frequentierte Dirtbikeanlage wurde um eine kleinere Bahn für Kinder und Anfänger ergänzt.
Die Kategorie „gebaut“ wurde gewählt, da sowohl multifunktional mit Zukunft als auch aufwendig interdisziplinär geplant und umgesetzt wurde.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Schwabing, München, Bayern
Beschreibung
Zentrum des 39,5 Hektar großen Wohnquartiers ist die sogenannte „Urbane Mitte“. Öffentliche Grünflächen verbinden die Gebäude und gliedern das Areal. Neben dem Stadtwald mit historischem Baumbestand und der „Großen Wiese“ gibt es besondere Orte wie den „StadtAcker“ oder den „Ort der Stille“. Ein Wegenetz für Fußgänger, Radfahrer sowie den ÖPNV erschließt relevante Orte miteinander: zum Beispiel das Olympiagelände mit Schwabing.
Das Erscheinungsbild des Planungsgebiets eines ehemaligen Kasernengeländes war von wild aufgewachsenem Baumbestand geprägt. Um dieses natürliche Potential zu erhalten, wurden die Eingriffe in den Bestand auf das erforderliche Minimum reduziert. Die zahlreichen Anknüpfungspunkte sowie der umfangreiche Baumbestand erforderten ein flexibles Erschließungsnetz. So werden sämtliche Wege sinnvoll verbunden, während die Wegeführung zugleich situativ reagiert und den Wurzelbereich der Bäume umgeht. Die Bäume verleihen dem Stadtteil mit seinen zahlreichen Neubauten den Charme eines „gewachsenen“, lebendigen Quartiers. In weiten Teilen konnten sie als ordnender Rahmen für Bebauung und Freiflächen erhalten werden. Neupflanzungen ergänzen diesen Bestand. Heute zeigt sich im Stadtwald ein harmonisches Nebeneinander aus Hainen, Gehölzgruppen, Baumplätzen und Lichtungen – ein idealer Ort zum Verweilen und Spielen. Der Stadtplatz hat die Form eins gestreckten Sechsecks. Er verbindet die öffentlichen Grünflächen mit den umliegenden Wohngebäuden, Läden und Cafés auf vielfältige Weise. Der umfangreiche alte Baumbestand des beiderseits anschließenden „Stadtwaldes“ prägt das Erscheinungsbild der „Urbanen Mitte“. Neu gepflanzte Robinien, die den Stadtplatz künftig locker überstellen, verbinden beide Teile.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Sendling, München, Bayern
Beschreibung
Im Strukturwandelprozess wurden verkehrsdominierte Flächen am Mittleren Rings Süd West mit hohen Immissionswerten des Durchgangsverkehrs, durch Tunnelum- und neubauten in einen 2,8 km langen urbanen Grünraum transformiert. Durch die Infrastrukturtrasse ehemals getrennte Stadtteile in München-Sendling konnten über das Bindeglied Heckenstaller Park, mit großzügigen Spiel- und Erholungsflächen, wiederverbunden für die Öffentlichkeit zurückerobert werden.
Über eine von Alleen gesäumte Mittelpromenade in der Garmischer Straße wurde der Heckenstaller Park mit dem Westpark als üppiges Grün für Mensch und Natur zu einem Raum verbunden, der nun neue Qualitäten für vielfältige Aktivitäten bietet. Ziel war es, sorgsam mit dem Gut Boden auf 600 Meter Länge und bis zu 70 Meter Breite umzugehen und dieses in einen Bürgerpark mit weiten Wiesenflächen zu transformieren. Der Park eröffnet den Bürgern Räume für Spiel und Sport oder Ruhe und Erholung. Auf der Nordseite rahmt eine baumbestandene Promenade grüne Wiesenflächen, auf der Südseite dominiert ein „Weidenfilter“. Fuß- und Radwege vernetzen den Park mit Wohngebieten lokal wie übergeordnet. Im Zentrum liegt ein abgesenkter Kinder- und Jugendspielplatz, dadurch bleiben weite Blickachsen erhalten, die die Größe des Parks wirken lassen. Als Leitidee diente der Freiraum als neues Verbindungselement: Das Quartier sollte zu einem öffentlichen nachhaltigen Grünraum für die Bürger werden. Die ehemals durch den intensiven Autoverkehr verlärmten Berereiche laden nun zur Erholung und vielfältigen Sportaktivitäten ein.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Schwabing Freimann, München , Bayern
Beschreibung
Im Strukturwandelprozess entstand auf dem ehemaligen Militärgelände ‚Funkkaserne‘ das neue Stadtviertel Domagkpark mit 1.800 Wohnungen für 4000 Menschen heterogenster Bevölkerungsgruppen (genossenschaftlicher und geförderter Wohnungsbau, z.T. Baugemeinschaften). Militärgebäude wurden umgenutzt und -gebaut (Ateliers, Flüchtlingszentrum, KITA, Studentenunterkunft, etc.).
Der neue Quartierspark basiert auf dem Bebauungsplan 2011 der LH München, sowie dem gewonnenen VOF Verfahren mit Gestaltungsvorschlag für die Freianlagen von LATZ+PARTNER. Ziel war es, sorgsam mit dem Gut Boden und dem wertvollen Altbaumbestand umzugehen und beides in einen Bürgerpark zu transformieren. Den 4,4 ha großen, zentralen öffentlichen Freiraum, als Kernstück des Quartiers, zu einem nachhaltigen Grünraum für die Anwohner werden zu lassen, mit Spielflächen und einem zentralen Platz im Osten, war die Leitidee. Breite Promenaden rahmen diesen Park. Quer durch den Park verlaufende, wassergebundene Wege reagieren flexibel auf vorhandene Bäume, verbinden südliche und nördliche Wohnbereiche und knüpfen über deren Quartiersplätze an deren innere Erschließung an.
Der zentrale Bereich des früheren Kasernengeländes wurde mit seinen bis zu 70 Jahre alten Bäumen und seinem wild gewachsenen Unterwuchs zu einem öffentlichen „Wald- und Wiesenpark“ weiterentwickelt. Im Fokus der Planung stand die größtmögliche Erhaltung, Integration und Weiterentwicklung des Baumbestands unter Berücksichtigung des typischen Bodenprofils der Münchner Schotterebene. Großzügige Perspektiven und Blickbeziehungen wurden durch ein behutsames Aufasten der Bäume, die Anlage weiter Rasen- und Wiesenflächen und ein Auslichten des Unterwuchses ermöglicht.
Eine tiefe Mulde im östlichen Parkbereich, die durch einen Gebäudeabriss entstand, wurde zu einer Kinderspieltopographie weitergebaut. Ein Steg überspannt diesen Erlebnisbereich und wird über Anbauten und Kletterseile zu einem multifunktionalen Spielgerät.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Stadtzentrum, Ludwig-Weimar-Gasse, 07743 Jena, Thüringen
Beschreibung
Ein Steinwurf vom historischen Rathaus und Marktplatz entfernt wurde in einem kooperativen Prozess eine kleine, aber feine grüne Wohlfühloase geschaffen und das obwohl in Jena die Flächen knapp sind. Es entstand auf einer Fläche von 150 m² eine gänzlich neue Art von nutzbarem, öffentlichem Grün für die Jenaer Stadtbevölkerung.
Jena ist eine prosperierende kleine Großstadt mit einem lebendigen Stadtzentrum. Die steinerne Innenstadt ist dicht bebaut und weist wenige nutzbare Grünflächen auf. Alle Brachflächen sind oder werden in nächster Zeit bebaut. So sollte auch eine kleine Brachfläche neben dem historischen Gebäude der Jenaer Stadtsparkasse mit einem Hochhaus bebaut werden. Die Stadt Jena und die Sparkasse erkannten aber gemeinsam, dass der Wert dieser Fläche für die Bevölkerung noch viel höher liegen kann, wenn ein grüner, klimatisch angenehmer Aufenthaltsort geschaffen würde. Die Gebäude in der Ludwig-Weimar-Gasse waren früher von Vorgärten begleitet. Auch hinter dem noch vorhandenen Natursteinsockel des Sparkassengebäudes gab es einen solchen Vorgarten. Hiervon inspiriert wurde ein sogenannter Pocketpark als innerstädtische öffentliche Grünfläche geplant und errichtet.
So entstand ein bepflanzter Vorgarten mit Mauersockel und aufgesetztem Zaun. Die Mauer verspringt in ihrer Höhe zu einer Sitzeinfassung und rahmt so eine Platzfläche in der städtebaulichen Lücke. Eine dichte Pflanzung aus Stauden und Gehölzen säumt den Platz, in dessen Zentrum sich ein mehrstämmiger Eisenholzbaum befindet. Pfeifenwinden an hohen Rankgerüsten begrünen diesen Rückzugsort auch in der Vertikalen intensiv. Die ausgewählten Pflanzen bieten in jeder Periode einen eigenen Aspekt, von den ersten Blüten im Frühling bis zur kräftigen Herbstfärbung des Eisenholzbaums und der grünen Decke des Immergrüns im Winter. So entsteht ein angenehmes Klima und lädt Menschen zum Pausieren und Verweilen ein.
Steckbrief der Einreichung (PDF)