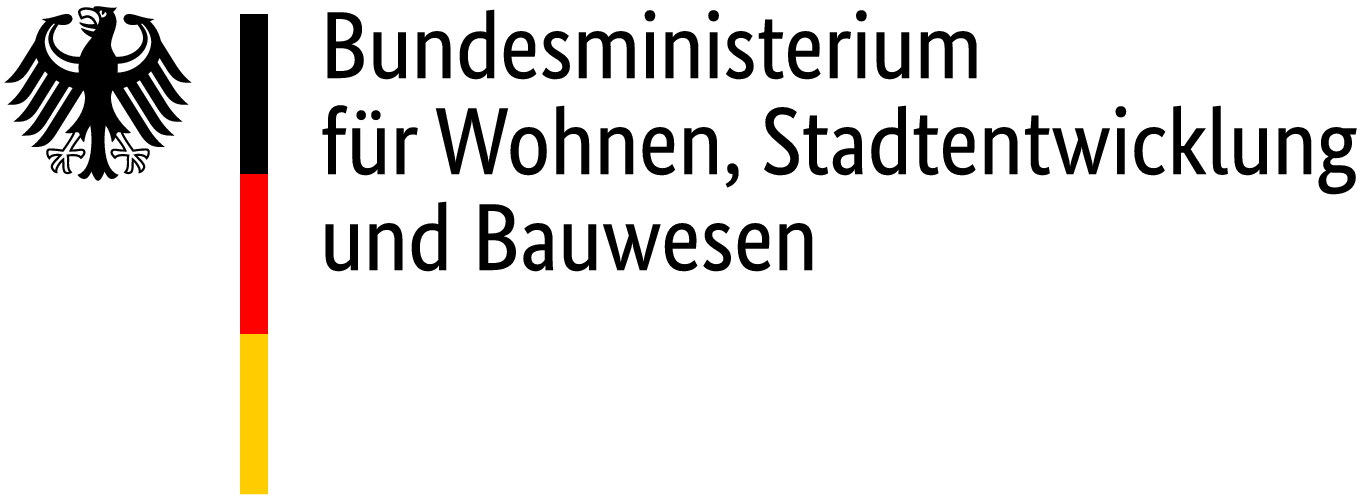Stadt Templin, Brandenburg
Beschreibung
Der Bürgergarten ist eine Park- bzw. Waldfläche am Rande des historischen Stadtkerns von Templin. Zu DDR-Zeiten standen dort ein FDGB-Ferienobjekt mit 400 Betten und ein Versorgungstrakt in Form einer Hyparschale mit einem angeschlossen Funktionsgebäude. Aufgrund der finanzieller Engpässe der Kommune konnte der Park viele Jahre nicht gepflegt werden. Die Nutzung als Ferienobjekt wurde Anfang der 90-er Jahre aufgegeben und kein Investor für eine Nachnutzung gefunden. So lag diese innerstädtische Grünfläche jahrelang brach. 2013 wurde deshalb unter reger Beteiligung der Bürgerschaft ein Ideen-Workshop durchgeführt mit dem Ziel, eine Nutzung zu finden und dem Ergebnis, diesen zu einem familienorientierten Freizeitpark zu gestalten. Bekräftigt wurde diese Idee durch das Kurstadtentwicklungskonzept aus 2012, welches die Aktivierung des Parkes empfahl, ihn aber auch als wichtiges Bindeglied zwischen Innenstadt, Kurmeile (touristischer Weg) und dem Kurgebiet mit der NaturThermeTemplin ansah und als Schlüsselprojekt identifizierte. Die Stadt Templin führte 2014 dann einen zweistufigen freiraumplanerischen Wettbewerb durch und setzt seit 2019 gemeinsam mit dem Wettbewerbssieger die Maßnahmen (Errichtung von Spiel- und Fitnessterrassen, Sanierung Teich, barrierefreie Wegeführung, Waldtor) um. Das ehemalige Bettenhaus wurde 2014 abgerissen und damit ein städtebaulicher Missstand an diesem Standort beseitigt. Dadurch wurde es wieder möglich, vom Bürgergarten aus ungehindert auf die Silhoutte der Altstadt zu schauen. Die Hyparschale als national bedeutsames Baudenkmal und Herzstück des Bürgergartens wurde inzwischen mit Mitteln aus dem Bundesförderprogramm zum Erhalt nationaler Denkmäler vor dem Verfall gerettet und soll einer multifunktionalen Nutzung zugeführt werden. Unter Berücksichtigung dieses dargestellten Werdeganges wurde die Bewerbung in der Kategorie “gebaut” gewählt, weil sich sich sowohl durch multifunktionale Projektansätze als auch Prozesse auszeichnet.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Puchheim Bahnhof, Planieweg in Puchheim, Bayern
Beschreibung
Für den Stadtnatur-Pfad wurde auf einer Fläche von ca. 600 qm ein asphaltierte Gehweg des zentral gelegenen Planiewegs entsiegelt und als artenreiche Magerwiese eingesät.
Vier verschiedenen Stationen (Stadtbeete; Bienen und Wildbienen, Gebäudebegrünung, Magerwiese und Landwirtschaft) informieren mittels Tafeln und interaktiven Elementen über die Bedrohung verschiedener Lebensräume und geben Tipps, wie diese erhalten, bzw. neu geschaffen werden können.
Ziel des Stadtnatur-Pfads war es, einen weiteren Beitrag zur mehr Biodiversität in der Stadt zu leisten. Die unterschiedlichen Ursachen für den Rückgang der Artenvielfalt werden aufgezeigt und Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität vorgestellt.
Wesentlich erschien zudem einen Bereich mit Aufenthaltsqualität zu schaffen. Die Puchheimer aller Altersklassen sollen ihren Stadtnatur-Pfad auch nutzen und genießen können. Für Kinder sind beispielsweise große Holzschafe, auf denen sie sitzen und herumklettern können, ein Highlight.
Zu guter Letzt gibt es für Jung und Alt einen Bereich, an dem Boule gespielt werden kann. Der Stadtnatur-Pfad kombiniert somit den Gedanken des Naturschutzes und der Artenvielfalt mit der Nutzung für Freizeitbelange. Damit wird gezeigt, dass sich diese Themen nicht gegenseitig ausschließen, sondern eine Kombination erfolgreich und sinnvoll ist.
Ein weiteres Plus des Stadtnaturpfads ist, dass er im weiteren Stadtgebiet fortgeführt werden kann und soll. Vorgesehen ist, weitere Themen an anderer Stelle zu vertiefen. So ist beispielsweise ein großes Wildbienenprojekt geplant, mit dessen Umsetzung in diesem Jahr begonnen wird.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Ursensollen, Ursensollen, Bayern
Beschreibung
Vor einigen Jahren haben sich in der Gemeinde Ursensollen mehrere Fledermausarten, darunter “Mopsfledermaus” und “Große Mausohren”, in einem ehemaligen Bräukeller, angesiedelt. Da rund um den Bräukeller auch Gefahrenstellen zu beseitigen waren um die Standsicherheit für den Felsenkeller zu gewährleisten, beabsichtigte die Gemeinde Ursensollen in diesem Zusammenhang den Fledermäusen ein artgerechtes Zuhause zu schaffen und den Felsenkeller in einen Fledermauskeller umzuwandeln. Das Projekt wurde mit Unterstützung des Amtes für Ländliche Entwicklung der Oberpfalz in Kombination mit einem Workcamp der Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd) aus Bonn organisiert. Innerhalb von drei Wochen wurde der ehemalige Bräukeller in Zusammenarbeit mit den örtlichen Baufirmen, dem Workcamp der ijgd, dem Naturpark Hirschwald, Landschaftspflegeverband des Landkreises Amberg-Sulzbach zu einem Fledermauskeller umfunktioniert. Insgesamt 16 Jugendliche aus der ganzen Welt beteiligten sich freiwillig an dem Naturschutzprojekt. Der Interkulturelle Austausch der Jugendlichen und der Naturschutz standen bei der Durchführung des Workcamps im Vordergrund. Bis vor etwa 100 Jahren wurden noch Bierfässer der Brauerei Gehr aus Ursensollen im sog. Bräukeller gelagert. Der Bräukeller ist ein Stück Ursensollener Heimatgeschichte. Durch die Sanierung des ehemaligen Bräukellers und dem Umbau in einen Fledermauskeller bleibt er den kommenden Generationen erhalten und leistet zudem einen wertvollen Beitrag für die Natur. Ziel war es, heimischen Fledermäusen eine artgerechte neue Heimat zu bieten, unser Augenmerk nicht nur auf Erholung und Freizeit zu legen, sondern auch und besonders auf den Artenschutz. Bereits kurz nach Abschluss der Maßnahme konnten von Fledermausexperte Rudolf Leitl hunderte von Fledermauseinflügen im ehemaligen Bräukeller gemessen werden und der Keller wird auch von den Fledermäusen als Winterquartier bereits angenommen, was uns in unsere Zielvorstellung bestätigt.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Stadt Olfen, Stadt Olfen, Nordrhein-Westfalen
Beschreibung
Das Projekt “Grüne Achse” in Olfen ist im Rahmen der Aufstellung des Integrierten Handlungskonzeptes für die Innenstadt der Stadt Olfen entstanden, in dem auch Ziel war, Grünräume miteinander zu verbinden und gestalterisch aufzuwerten. Ziel war es, die Alte Fahrt, den St.Vitus-Park und den Stadtpark zu einem Grünband zusammen zu führen, das die Innenstadt auf der östlichen Seite umschließt.
Um attraktive Übergänge sowie Wege- und Sichtbeziehungen zwischen den Grünräumen zu schaffen, wurde dieser Bereich umgestaltet. Die Alte Fahrt, der St.Vitus-Park sowie der Stadtpark wurden mit verschiedenen Maßnahmen qualitativ aufgewertet, um mehr Aufenthaltsqualität zu schaffen. Eine Hafeninsel im alten Hafenbecken wurde gebaut, um einen attraktiven Treffpunkt und Aufenthaltsbereich für Bürgerinnen und Bürgern hervorzubringen. Eine Eislauffläche im Bereich der Alten Fahrt wurde angelegt, um im Bereich der Grünflächen Aktivitäten ausüben zu können und Kindern ebenfalls eine Fläche zum treffen und verweilen anzubieten. Der Bereich der Eislauffläche beinhaltet ebenfalls einen Rodelhügel, der während der Sommermonate eine schöne Blütenpracht bietet und während der Wintermonate im Fall von Schnee als Rodelhügel genutzt werden kann. Zudem wurde ein Calisthenicspark im Bereich des St.Vitus-Stiftes geschaffen, der für sportliche Aktivitäten genutzt werden kann. Der Einklang, zwischen Natur und Treffpunkte für Menschen schaffen, ist eines der obersten Projektziele. Denn die Natur soll in weiten Teilen sich selber überlassen werden und sich frei entfalten können, dennoch soll der Mensch ebenfalls die Möglichkeit haben, an der Natur teil zu haben und diese genießen zu können. Mit Hilfe von gezielten Maßnahmen in dem beschriebenen Bereich konnten attraktive Aufenthaltsbereiche geschaffen werden, neue Wegeverbindungen angelegt und Grünbereiche durch Schaffen von zueinander verlaufenden Wegebeziehungen inhaltlich und räumlich miteinander verbunden werden.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Historische Altstadt, hinter VHS, Stadt Detmold , Nordrhein-Westfalen
Beschreibung
Nach energetischer Sanierung des Gebäudes der Volkshochschule und Anschluss an das Fernwärmenetz war das umgebende Gartengelände durch die Bauarbeiten in marodem Zustand. Bis dahin auch bekannt als Hundeklo, Angstraum, Abkürzung, Treff von Jugendlichen in den Abend- und Nachtstunden. Es wurde eine neue Nutzung zur Attraktivitätssteigerung überlegt. Nach Besuch der Heilpflanzengärten im Umweltzentrum Heerser Mühle in Bad Salzuflen und LWL-Freilichtmuseum in Detmold entstand die Idee, hinter der VHS einen Heilpflanzengarten anzulegen. Das Gelände wurde mit Hilfe der Stadt vorbereitet. Kooperation mit der Hof-Apotheke Detmold (Sponsoring, Planung, Führungen) und VHS. Unterstützung durch die Peter Gläsel Stiftung sowie Spender.
Planung und Anlage von 4 Heilpflanzenbeeten sowie Sanierung und Bepflanzung einer Mauer, Bau eines Platzes für Papiercontainer, Neuinstallation von 2 Leuchten; Aufarbeitung von 3 vorhandenen Ruhebänken, Pflasterarbeiten, Anpflanzung Quitte, Mispel.
Im Heilpflanzengarten “Oase der Stille” sollten zukünftig sachkundige Führungen durch eine Apothekerin stattfinden, um Interessierte über Wirkung und Anwendungsweise von Heilpflanzen zu informieren, erklärende Schautafeln zur Ergänzung des Angebotes installiert werden; Forum schaffen für Freiluftkonzerte (‘Musik im Hinterhof’, Studierende Hochschule für Musik); Lesungen (“Leselust”); Kunstausstellungen; ‘Krumme Kulturnacht’ der Einzelhandelsgeschäfte der anliegenden Krummen Straße; Tai-Chi und Yoga (VHS); Ruhe- und Erholungszone für Bürgerinnen und Bürger; Touristische Führungen durch den historischen Stadtkern der ehemaligen Residenzstadt.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Remstal – von der Quelle der Rems in Essingen bis zur Mündung in den Neckar in Remseck am Neckar, Baden-Württemberg
Beschreibung
Charakteristisch für die Region Stuttgart ist die hohe landschaftliche Vielfalt – sie hat großen Anteil an der hohen Attraktivität der Region als Wohn- und Wirtschaftsstandort. Dies belegt eine in der Region Stuttgart 2013 und 2018 durchgeführte repräsentative Bürgerbefragung, die Natur und Landschaft als den mit Abstand wichtigsten Standortfaktor ausweist.
Mit dem Landschaftspark Region Stuttgart verfügt der Verband Region Stuttgart über ein wirksames Instrument, um diese Qualität aktiv weiterzuentwickeln und die Gemeinden planerisch und finanziell dabei zu unterstützen, Erholungsräume, aber auch ökologisch wertvolle Bereiche zu schaffen. Ein wichtiger Beitrag zum Erreichen der UN-Nachhaltigkeitsziele und von zentraler Bedeutung für Komfort und Sicherheit im Siedlungsbereich (insbesondere vor dem Hintergrund von Klimaveränderungen).
In diesem Kontext entstand die Bewerbung um eine interkommunale Gartenschau im Remstal – sie bot die besondere Chance, in einem zeitlich begrenzten Rahmen kommunales Handeln auf stadt- und freiraumplanerische Ziele und Projekte sowie damit verbundene Zukunftsthemen zu fokussieren und zugleich das im Raum vorhandene politische und gesellschaftliche Engagement über fachliche und administrative Grenzen hinweg zu bündeln und auszubauen.
Mit der gemeinsamen Durchführung einer Gartenschau von 16 Städten und Gemeinden, die zudem drei unterschiedlichen Landkreisen und den beiden Planungsregionen Ostwürttemberg und Stuttgart zugeordnet sind, wurde Neuland betreten. Ziel war es, das gesamte Remstal als einheitlichen Naturraum und gemeinsamen Wohnort von mehr als 330.000 Menschen durch konkrete Maßnahmen gestalterisch und ökologisch aufzuwerten sowie für die als Erholung von rund drei Millionen Menschen im Einzugsbereich zu etablieren und bekanntzumachen. Ein Anspruch mit Pioniercharakter, Einsatz der Gartenschau als neues Instrument der Regionalentwicklung – und das gleichermaßen im Verdichtungs- wie auch im ländlichen Raum.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Flächen in allen 5 Stadtteilen, Stadt Riedstadt mit den Stadtteilen Crumstadt, Erfelden, Goddelau, Leeheim und Wolfskehlen, Hessen
Beschreibung
Riedstadt verfolgt das Ziel einer Förderung der Biodiversität schon seit 30 Jahren, was sich in vielen Projekten niedergeschlagen hat (z.B. Renaturierung von Stromtalwiesen – siehe www.riedstadt.de/stromtalwiesen – oder die Anlage von Hochzeitswiesen mit mittlerweile rund 500 Bäumen alter und regionaler Obstsorten). Dies sollte nun auch auf die innerstädtischen Grünflächen ausgeweitet werden: Das Straßenbild wurde in vielen Bereichen von den üblichen Ziergehölzpflanzungen (Mahonien, Lonicera, Schneebeeren etc.) geprägt, die trotz des hohen Pflegeaufwands sehr unansehnlich geworden waren und eine niedrige biologische Vielfalt aufwiesen (artenarm, geringe genetische Viefalt aufgrund Stecklingsherkunft aus Baumschulen). Ziele: Deutliche Erhöhung der biologischen Vielfalt und der ästhtischen Qualität bei Senkung des Pflegeaufwands. Maßnahmen: a) Vollständige Neugestaltung: Entnahme des Vorbewuchses (Ziergehölze), Bodenaustausch zur Schaffung langfristig guter Wuchsbedingungen und Einsaat mit einer eigens zusammengestellten artenreichen Mischung aus regional typischen wärme- und trockenheitsverträglichen Wiesen- und Saumarten aus Regiosaatgut, die lediglich zweimal pro Jahr gemäht werden. b) Umwandlung vorhandener Rasenbestände in artenreiche Wiesen durch ergänzende Einsaat und Umstellung der Pflege. c) Neu anzulegende Flächen werden nicht mehr als Rasenflächen ausgeschrieben, sondern ebenfalls als artenreiche Wiesen aus Regiosaatgut angelegt. Die Pflege dieser Flächen (a-c) erfolgt durch eine zweischürige Mahd. In Teilbereichen haben sich Bürger/Bürgerinitiativen an dieser Umgestaltung beteiligt, zudem haben Bürger die Möglichkeit, Grünflächen-Pflegepatenschaften zu übernehmen (aktuell: 139 Pflegepaten, die sich um insgesamt 161 städtische Grünflächen kümmern). Wahl der Projektkategorie: Gebaut, weil die Umwandlung/Neugestaltung im Zentrum steht – funktioniert natürlich nur, wenn auch die Pflege angepasst wird (gepflegt) und die Bevölkerung einbezogen wird (gemanagt).
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Innenstadt, Stadt Marktredwitz, Bayern
Beschreibung
Zunächst sollte lediglich der Spielplatz neugestaltet werden, der sehr in die Jahre gekommen war. Aus diesem relativ kleinen Projekt wurde dann die Sanierung des kompletten Parks. Die benachbarte Grundschule, Förderschule, der Hort sowie die Seniorenheime sollten alle den bestmöglichen Nutzen aus dem Kirchpark ziehen. Somit wurde das Projekt in enger Zusammenarbeit aller Anlieger sowie der Stadt Marktredwitz und der ev.-luth. Kirche (teilw. Eigentümer) realisiert. Sehr wichtig war uns der Inkusionsgedanke. Alt und Jung, in irgendeiner Form behindert/körperlich eingeschränkt oder nicht, alle Einwohner und Einwohnerinnen sowie die Besucher sollten den Park optimal nutzen. Das war für die Planer eine nicht ganz einfache Aufgabe. Alle Belange sollten berücksichtig werden, hinzu kam die Barrierefreiheit und die Anfahrbarkeit für die Feuerwehr.
In vielen Gesprächen wurde die beste Lösung ausgearbeitet.
Aus einer dunklen, in die Jahre gekommenen Fläche, welche früher der Stadtfriedhof war, wurde so ein wundervoller Park in mitten der Stadt. Ein echtes Highlight.
Besonders der Inklusionsspielplatz für alle Generationen hat es den Besuchern angetan. Hier sind die Geräte bereits ab morgens besetzt. Außerdem wurden Hochbeete, die auch für Rollstuhlfahrer benutzbar sind geschaffen, aus denen ein Gemeinschaftsprojekt mit den Schulen enstand. Jung lernt hier von Alt und vielleicht auch andersherum. Auch die Kleinen durften einen Beitrag leisten. In Zusammenarbeit mit einer Künstlerin entstand ein lebensgroßer Löwe aus Mosaiken, welcher nun über den Kirchpark und seine Besucher wacht.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Kernstadt, Stadt Bad Saulgau, Baden-Württemberg
Beschreibung
Der NTP beginnt inmitten der städtischen Kurkliniken mit Thermalbad und angrenzendem Wohngebiet im Westen Bad Saulgaus.
Die Vielzahl an ökologischen Maßnahmen der Stadt (7 Naturlehrpfade, 15 km Gewässerrenaturierungen, 120 ha Biotopanlagen, Umwandlung fast des gesamten Einheitsgrüns in artenreiche Anlagen im besiedelten Bereich) wird im 60 ha großen NTP zusammengefasst und allen Bürgern, Gästen und Interessierten zugänglich gemacht. Der NTP ist breit aufgestellt und befasst sich mit allen Themen des Bereichs Naturschutz: Pflanzen, Tiere, Wasser, Geologie + Landschaft, Luft.
Neu gebaut wurde der Themen- und Erlebnisweg Wasser (3,5 km) mit Stegen, Plattformen und ausführlichen Infos zu den Themen Grundwasser, Wasserkreislauf, Oberflächengewässer. 2 Biberreviere mit artenreichen Biotoplandschaften sind dort entstanden. Durch diese Wiedervernässung siedelten sich viele Tierarten aus der Roten Liste an wie Eisvogel, Wasserralle, seltene Libellenarten etc. Zudem haben vier Spechtarten und seltene Singvogelarten ihr Revier im NTP.
Der aus 2 Forsthütten umgebaute, zentral gelegene InfoPunkt wird für Schulungen, Naturveranstaltungen, Führungen etc. benutzt. Zum InfoPunkt gehören auch sanitäre Anlagen, eine Feuerstelle und Infos zu Themen wie Funktionen des Waldes, Tiere & Pflanzen des Waldes, Wald im Klimawandel. Von April bis November ist der InfoPunkt auch an Wochenenden von geschultem Personal besetzt.
An 10 interaktiven Naturerlebnisstationen können Kinder spielerisch über die Natur lernen. Bestandteile sind z.B. Biberkletterburg, Stationen zur Erkundung von Waldvögeln, des Bodenlebens, des Wasserkreislaufs, ein Hörspiel, eine Insektenhüpfstation.
Neben Familien, Bürgern, Gästen, Schulen, Kindergärten und Vereinen nehmen auch Kommunen, Landkreise, Behörden und Naturschutzorganisationen das Angebot an.
Die städtische Tourismus GmbH betreibt den stark frequentierten NTP. Viele geschulte Guides sind im Einsatz, die auf Anmeldung Veranstaltungen für Groß und Klein anbieten.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Eberswalde, Brandenburg
Beschreibung
Die Verkehrsfläche, die durch den Umbau des innerörtlichen Knotenpunktes der Bundesstraße B167 Eisenbahn- und Breite Straße nicht mehr benötigt wurde, wurde zusammen mit der Fläche des alten Parkplatzes an der Goethestraße zu einer öffentlichen Freifläche gestaltet. Der Platz befindet sich im historischen Denkmalbereich „Stadtkern Eberswalde“ und im Bodendenkmalbereich direkt neben dem Baudenkmal „Adler-Apotheke“, in der sich das städtische Museum befindet. Historisch befand sich in dem Bereich das Mühlentor, eines der steinernen Stadttore aus dem Mittelalter vor dem sich eine Mühlenanlage an dem einstigen Fluss Finow befand. Der Standort des Mühlentors wurde durch anthrazitfarbenes Pflaster visualisiert. Die für den Umbau zur Verfügung stehende Verkehrsfläche war zum größten Teil versiegelt. Der neue Platz ist der nördliche Eingangsbereich zur historischen Altstadt. Die Fläche wurde zu einem öffentlichen barrierefreien Treffpunkt, der zum Verweilen einlädt ausgebaut. Die Anbindung der topografisch tiefer liegenden Goethestraße an die neu ausgebaute Kreuzung der B167 erfolgte über eine großzügige Freitreppenanlage mit Rampe und einer attraktiven Freifläche mit hoher Aufenthaltsqualität. Um die Höhenunterschiede zwischen Treppenanlage und Rampe auszugleichen und eine optische Trennung zu erzielen wurden Granitelemente angeordnet. Granitblöcke wurden als punktuelle Sitzelemente integriert. Seitlich der Treppenanlage wurden Bänke und Abfallbehälter angeordnet. LED-Leuchten, die in die Granitblöcke und Treppenstufen eingelassen sind, geben im Dunkeln eine Orientierung. Drei Lichtstelen längs zur Treppenanlage ergänzen die Anlage. Die Freiflächen wurden als Grünfläche mit einer Bepflanzung aus Bäumen, Sträuchern und Frühblühern gestaltet. Eine Reihe Winterlinden bilden eine Blockrandbegrenzung entlang der Eisenbahn- und Breite Straße. Vor dem Museum wurde die Skulptur „Flussgöttin Finow“, die ein Verbindungsglied zum Finowkanal darstellt in Szene gesetzt.
Steckbrief der Einreichung (PDF)