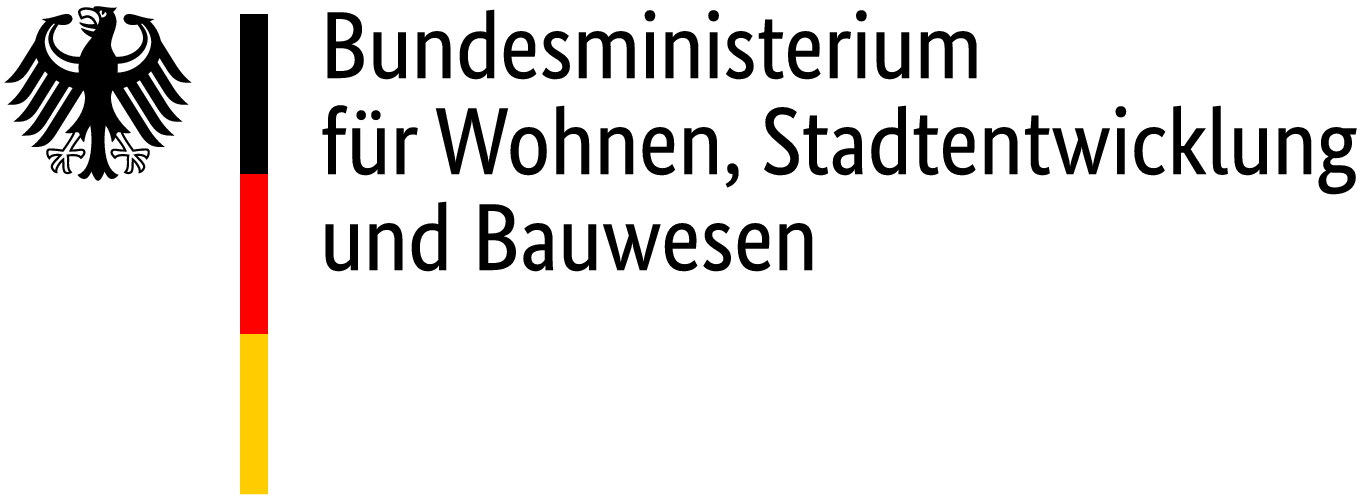Königsee-Rottenbach, Rottenbach, Thüringen
Beschreibung
Der Bahnhof und die Bushaltestelle Rottenbach sind durch ihre Lage im Schwarzatal in Thüringen ein wichtiger Verteilerpunkt. Züge halten hier, jedoch stand der Bahnhof lange leer und war kein Aushängeschild für die landschaftlich bemerkenswerte Region, die auch Touristen gerade im Sommer besuchen.
Die Internationale Bauausstellung (IBA) Thüringen erklärte der Bahnhof Rottenbach 2014 im Rahmen der Initiative der Zukunftswerkstatt Schwarzatal zum ersten IBA Kandidaten. Das Vorhaben zeigte den Anspruch des StadtLands Thüringen mit am deutlichsten: durch gute Architektur, Engagement und Partnerschaften den ländlichen Raum attraktiver machen.
Das Motto für Bahnhof Rottenbach lautet heute daher passenderweise: Reisende, verweilt doch!
Das Bahnhofgebäude wurde qualitätsvoll saniert und mit einer innovativen, auf flexible Nutzung ausgerichteten Raumkonzeption ausgestattet. Und das Umfeld des zukünftigen BahnHofladens Rottenbach ist in seiner neuen Gestaltung diesem hohen Anspruch gerecht. Wie ist das alles zum Stand gekommen?
Die Initiative ‚Zukunftswerkstatt Schwarzatal’ mit dem Schwerpunkt ‚BahnHofladen Rottenbach’ wurde nach erfolgreicher Bewerbung in die Projektgalerie der Bundesstiftung Baukultur ‚Stadt und Land’ im Frühjahr 2015 aufgenommen.
In Kooperation mit der IBA Thüringen hat die Stadt Königssee-Rottenbach eine Ideenstudie zur Entwicklung des Verkehrsverknüpfungspunktes und Umfeldes BahnHofladen Rottenbach in Auftrag gegeben. Eingeladen wurden in 2015 fünf renommierte regionale, nationale und internationale Landschaftsarchitekturbüros. Das atelier le balto könnte ihr Projekt STADTLAND! INSELN weiterentwickeln.
Durch die Zuwendung für Ausstattung und Vermarktung des BahnHofladens Rottenbach über Bundesprogramm “Regionalität und Mehrfunktions-häuser” des Thüringer Landesamtes für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR) könnte der Bahnhof ihr neues Gesicht und Funktion bekommen.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Zentrum, Chemnitz, Sachsen
Beschreibung
Die Chemnitz umfließt das engere Stadtzentrum in weitem Bogen. Bis vor einiger Zeit war sie nicht sichtbar hinter Fabrikgebäuden und unter Straßen verborgen. Unser Projekt holte den namensgebenden Fluss optisch und funktionell in die City zurück. Die seit Jahren verfolgte Entwicklung eines gesamtstädtischen grünen Bandes wurde damit mitten in der Chemnitzer City vervollständigt.
Die konkrete städtebauliche Situation ist durch die Lage an weiträumigen innerstädtischen Verkehrsachsen gekennzeichnet, die räumliche Bezüge nur schwer herstellen lassen. Der Fluß wurde an diesem zentralen Ort Anfang des Jahrhunderts überdeckelt. Die Zerstörungen des 2. Weltkrieges vernichteten die Bebauung und beließen die nutzlos gewordnene Überdeckelung des Flusses, der somit aus dem Stadtbild verschwand.
Diese Überdeckelung wurde 2012 beseitigt. Nun galt es, für die wieder gewonnene Fläche, “Moritzpark” genannt, eine Symbiose aus öffentlicher und privat organisierter Nutzung zu entwickeln.
Zusammen mit einem Gastronomen wurde die Fläche in den private betriebene “Uferstrand” und den öffentlichen “Uferpark” geteilt. Die Planung folgte dieser funktionellen Teilung. Mit der geschaffenen Terrassierung am Fluß wird eine klare Flächenzuordnung, sowohl funktionell und gestalterisch umgesetzt.
Die „Chemnitzterrasse“, ein balkonartige Konstruktion, ist ein Platz der – bedingt durch ein technisches Bauwerk der Fernwärme – über dem Flussufer schwebt. Von hier aus kann der Fluss am besten erlebt werden. Dahinter entwickelt sich die Sandfläche des “Uferstrandes” , an der Annaberger Straße steht als Sicht- und Lärmschutz zugleich- das gastronomische Versorgungsgebäude.
Eine Besonderheit ist die großformatige Skulptur des Holzgestalters Prof. Hans Brockhage, die hier einen neuen angemessenen Standort fand.
Nach Fertigstellung übernahm der Gastronom vertraglich auch Teile der öffentlichen Parkanlage zur Reinigung, während die Verkehrssicherung und Grünpflege durch das Grünflächenamt erfolgt.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Puchheim , Bayern
Beschreibung
Von der Müllkippe zum Bürgerpark – so lässt sich die Geschichte der Kennedywiese zusammenfassen. Der heutige Stadtteil Planie war bis Ende der 1940er Jahre die Müllkippe Münchens. Nach dem 2. Weltkrieg begann eine intensivere Besiedlung Puchheims, die ihren sichtbaren Höhepunkt in der Bebauung der Planie mit einer Hochhaussiedlung für ca. 2500 Bewohner hatte. Die Kennedywiese wurde als Spielplatz und grüne Lunge genutzt. Seit 2015 ist die Planie nun Sanierungsgebiet und wurde in das Städtebauförderprogramm Sozialer Zusammenhalt (ehem. Soziale Stadt) aufgenommen. Das Projekt Bürgerpark Kennedywiese gehört zum Herzstück der Sanierung – der Entwicklung eines neuen Stadtzentrums. Die Anbindung des neuen Bürgerparks an das Ortszentrum stellt für die Umgestaltung der Stadtmitte und den Neubau von Bibliothek, Musikschule und Volkshochschule eine wichtige Herausforderung dar. Der Bürgerpark Kennedywiese soll als Ort der Identifikation wirken über das Quartier Planie hinaus, das mit einem Migrationsanteil von 50% aus 70 unterschiedlichen Nationen gekennzeichnet ist. Um dies zu erreichen wurde mit einem breit angelegten und sehr kreativen Beteiligungsformat die Planung und Umsetzung erarbeitet. So entwickelte sich ein demokratischer Ort, der eine nachhaltige Gemeinschaft sowie gegenseitige Wertschätzung auf Dauer ermöglicht.
Ergebnis ist eine Parkanlage mit weitläufigem Wiesengrund für Bewegung, Ruhe, Naturerleben und Festlichkeiten. In den Baumbestand integriert finden unterschiedliche Altersgruppen Spielangebote mit individuell für den Bürgerpark angefertigten Klettertürmen, Ballspielfeldern, Trampolinen, usw.. Umfangreiche Aufenthaltsbereiche im Baumhain, am Wasserfeld und liebevoll gestaltete Detailbereiche laden auch die ältere Generation in den Park ein.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Walle, Bremen, Bremen
Beschreibung
Das Projekt „Willy-Hundertmark-Platz“ ist ein Projekt aus dem Integriertem Entwicklungskonzeptes (IEK) für Gröpelingen. Das Integrierte Entwicklungskonzept (IEK) wurde 2013/2014 unter intensiver Beteiligung von Akteuren aus dem Stadtteil erarbeitet. Die Umsetzung erfolgt aus verschiedenen Programmen: Stadtumbau West, Soziale Stadt, Städtebaulicher Denkmalschutz und dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE).
Der neue Quartiersplatz entstand auf der Fläche einer ungenutzten Stadtbrache eines städtischen Versorgungsträgers (swb) und wurde auf Initiative der örtlichen Politik und der VertreterInnen der städtischen Planungsressorts einer öffentlichen Interimsnutzung überlassen.
Der neue Quartiersplatz wurde in der Ideenfindung aus einem intensiven Beteiligungsverfahren abgeleitet und im Folgenden passgenau auf die Wünsche aus dem Quartier zugeschnitten:
Es sollte eine freundliche multicodierte Freifläche entstehen, die maßgeblich durch den Geist des Ortes und die Atmosphäre des angrenzenden Umspannwerks geprägt ist. Das Thema der fließenden Elektrizität wurde in die Gestaltung integriert und gibt dem Platz zusammen mit seiner neuen Funktion als attraktiver Begegnungs- und Aufenthaltsort eine neue, ganz eigene Qualität.
Ausgestattet ist der Willy-Hundertmark-Platz mit einer sandfarbenen Asphaltoberfläche, die barrierefrei und witterungsunabhängig ganzjährig nutzbar ist. Auf der Fläche zeichnet sich in leicht abstrahierter Form ein Schaltplan ab. Er präsentiert sich als künstlerisches “Bild” und lädt gleichzeitig zur kreativen Aneignung und zum informellen Spielen ein. Gerahmt wird die Platzfläche durch eine malerische vorhandene Rotbuche, die Kulisse zum Umspannwerk bilden drei neue Amberbäume, Farne und Gräser.
Für das Projekt wurde die Projektkategorie „gebaut“ gewählt, da es sich bei der Platzgestaltung um eine bauliche Neuanlage handelt.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Stadt Perleberg, Brandenburg
Beschreibung
Die Altstadt von Perleberg ist vom Flusslauf der Stepenitz und einem „Grünen Saum“ umgeben, welcher schon vor über 100 Jahren als Naherholungsraum genutzt wurde. Während viele städtische Gebäude und Straßen in den vergangenen Jahren bereits umfangreich saniert wurden, war es an der Zeit, sich dem Hagen als Teil der historischen Altstadt und des Denkmalbereichs zu widmen. Der Grünbereich wirkte vernachlässigt, Spielplatz, Sitzbänke, Promenadenwege und Beleuchtung waren „sehr in die Jahre gekommen“. Die Zielstellung war deshalb, den Hagen unter Beachtung der historischen und landschaftlichen Einbindung behutsam aufzuwerten, Aufenthaltsmöglichkeiten für Jung und Alt zu schaffen sowie die fußläufigen Wege zu verbessern bei gleichzeitiger Haltbarkeit und Pflegeleichtigkeit der neuen Anlagen.
Der Umfang der baulichen Maßnahmen begründet die Bewerbung in der Projektkategorie”gebaut”. Es wurden fast 1 Kilometer alleenbestandene Promenadenwege saniert. Am Ufer der Stepenitz wurden Bereiche mit Sitzstufen gestaltet und die Kahnanlegestelle erneuert. Der Spielplatz wurde komplett neu konzipiert, wobei sich der Landschaftsbezug durch ungeordnete Kanthölzer im Kletterparcours widerspiegeln sollte (Schilf, Weidenbruch). Es wurde auch an Wippen und Trampolin für größere Kinder gedacht sowie Sitzmöglichkeiten für Erwachsene. Die Ausstattung mit Sitzbänken, Liegen, Fahrradbügeln und Abfallbehältern folgte einer Designlinie in Holz und Metall. Die Silhouette der Altstadt kann fortan durch einen Fotorahmen abgelichtet werden. Pflanzflächen wurden bewusst nur im Bereich des Spielplatzes zur Gliederung angelegt, es sollten keine künstlichen “Rabatten” in der Naturlandschaft entstehen. Die Lindenalleen wurden ergänzt.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Gröpelingen, Bremen, Bremen
Beschreibung
Das Projekt „Öffnung des Quartiersbildungszentrums ins Quartier“ ist ein Projekt aus dem Integriertem Entwicklungskonzept (IEK) für Gröpelingen. Das Integrierte Entwicklungskonzept (IEK) wurde 2013/2014 unter intensiver Beteiligung von Akteuren aus dem Stadtteil erarbeitet. Das Projekt „Öffnung des Quartiersbildungszentrums ins Quartier“ ist eines von sieben Projekten in der Projektfamilie „Laufbahnen/Bildungswege“.
Das 2015 erbaute und inzwischen sehr erfolgreiche QBZ bildet eine bauliche Einheit mit der Grundschule an der Fischerhuder Straße. Durch die steigende Bedeutung der Grundschule Fischerhuder Straße und QBZ Morgenland für den Stadtteil Gröpelingen ist auch der Anspruch an die Freianlagen des Schulgeländes gestiegen. Die Nutzungsansprüche sind vielfältiger geworden. Darüber hinaus bestand ein großer Sanierungsbedarf auf dem Gelände. Dieses erforderte in Teilen eine Neugestaltung der Flächen. Dabei sollte sowohl für die Schüler der Grundschule, die Kinder und Jugendlichen des Stadtteils als auch für die Besucher des QBZ ein attraktives Freigeländes mit vielfältigem Nutzungsangebot geschaffen werden. Ein Projektansatz mit einer großen Robustheit und einer einladenden Strahlkraft auf das umgebende Quartier war gewünscht.
Für das Projekt wurde die Projektkategorie „gebaut“ gewählt, weil die Hauptbaumaßnahme im Herbst 2019 abgeschlossen und der Schulhof feierlich eingeweiht wurde. Zwei markante Ausstattungselemente, die Spiel- und Aufenthaltspodeste im Wäldchen und das große Kletter- und Rutschen-Gerät im Sandspielbereich befinden sich noch in der Fertigung, bzw. in der Vergabe und werden im Frühjahr Sommer 2020 aufgebaut. Schulhof und Sportfläche sind bis auf diese zwei fehlenden Elemente trotzdem bereits in voller und intensiver Nutzung.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Stadtteil Reuschberge, Stadt Lingen (Ems), Niedersachsen
Beschreibung
Mit Bekanntwerden der Auflösung des Bundeswehrstandorts Lingen ergab sich in 2005 für die Stadt Lingen (Ems) die Gelegenheit, ein ca. 30 ha großes Kasernengelände in einzigartiger Lage (1 km Luftlinie zur Innenstadt) zu erwerben und einer neuen Nutzung zuzuführen. Unter der Prämisse „Stadtnahes Wohnen in grüner Umgebung“ sollte ein völlig neuer Stadtteil entstehen, der sowohl ein modernes Wohngebiet mit unterschiedlichsten Wohnformen, verschiedenen Versorgungsangeboten, einem Haus der Vereine als Begegnungsort, als auch einen auf ca. 15 ha ausgelegten Stadtpark miteinander verbinden soll. Südlich des geplanten Wohnviertels und verbunden durch eine 15.000 qm große Wasserfläche, die gleichzeitig als Regenrückhaltebecken dient, wurde eine großzügige Parkanlage als Ort der Begegnung und Bewegung für Bürger/-innen sämtlicher Altersgruppen geschaffen. Der Park umfasst einen wertvollen alten Baumbestand, viele neue Anpflanzungen, weitläufige Grünflächen mit biologisch wertwollen Magerrasenflächen und attraktive Freizeitanlagen wie Spielflächen, den sog. “Playgrounds” zu verschiedenen Themenschwerpunkten (Sand/Wasser, Schaukel/Bewegung mit barriefrei zugänglichen Spielgeräten und Klettern), einen Dirtpark für BMX-Fahrer, Mehrgenerationen-Outdoorfitnessgeräte entlang der gut ausgebauten Spazierwege, viele Verweilmöglichkeiten sowie eine jeweils 500m und 200m lange, wettkampffähige, Inlineskaterbahn mit innenliegender Veranstaltungsfläche. Darüber hinaus integriert der neu geschaffene Park die bestehenden, natürlichen Landschaftsräume der angrenzenden Emsauen und bietet damit Lebensraum für die heimische Flora und Fauna. Der im Sommer 2016 offiziell mit einem großen Kinderfest eröffnete Park wird seither sowohl von Lingener Bürger/-innen sämtlicher Altersklassen als auch Gästen aus dem Umland zum Verweilen und Erholen rege genutzt. Eine sich bereits in Planung befindliche Parkoursportanlage soll das Angebot weiter ergänzen und in Kürze gebaut werden.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Stadtbezirk Süd Stadtteil Karlshöhe, Stuttgart , Baden-Württemberg
Beschreibung
Die stadtklimatische Situation im Bereich der Stuttgarter Kessellage ist durch die Feinstaubbelastung und starke Erwärmung in den Sommermonaten sehr problematisch. Baumpflanzungen sind Maßnahmen, um dieser Problematik entgegen zu wirken. Schon 2012 wurden in Stuttgart-Süd 8 Baumstandorte in offener Bauweise in den Straßenraum eingebracht. Nun wurde der Straßenraum stadteinwärts im weiteren Verlauf durch Baumstandorte in unterschiedlicher Bauweise aufgewertet. Im jetzigen Projekt `Neues Grün – Baumstandorte Möhringer Straße / Adlerstraße´ wurden 26 Baumquartiere erstellt. 23 Quartiere sind mit Straßenbäumen als Hochstämme bepflanzt. Aufgrund des hohen Leitungsvorkommens im Straßenraum wurden 3 Standorte mit Strauchrosen begrünt. Ergänzend sind Zwiebelpflanzen und Ansaat eingebracht. Markant im Projekt ist die Umgestaltung des Kreuzungsbereiches Möhringer Straße Adlerstraße. Hier wurden 8 Gehwegnasen mit 8 Pflanzbeeten hergestellt. Davon sind 6 offene Baumstandorte und 2 Beete mit Strauchrosen im Kreuzungsbereich neu hergestellt. Die Fußgängerquerungen sind dadurch erleichtert. Der Kreuzungsbereich kann nicht mehr störend beparkt werden, Sitzpoller ermöglichen den Aufenthalt und die 6 Bäume und die beiden mit Rosen bepflanzten Quartiere werten die qualitätsvolle Bebauung auf. Die Blickbeziehung auf die Matthäus – Kirche wird durch die Bäume positiv unterstrichen. Fahrradständer und Parkscheinautomat sind in die Gestaltung integriert und die anliegende Gastronomie profitiert im Außenbereich vom Kreuzungsumbau.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
66649 Oberthal (Saar), Poststrasse, 66649 Oberthal (Saar), Saarland
Beschreibung
Durch eine steigende Hochwasserproblematik des nahegelegenen Landschaftsschutzgebietes (Imweiler Wies) wurde von der Gemeinde Oberthal in den letzten Jahren eine Konversionsfläche in Ortskernlage, sowohl funktional als auch städtebaulich-landschaftlich geplant und gebaut. Es bestand die Chance, durch Neuordnung die Stadtbildpflege zu fördern und die Qualität der Freiräume weiter zu stärken. Die Nähe zum Bostalsee sowie die geologischen und naturräumlichen Besonderheiten bieten Touristen und Einheimischen Anlass, das Gebiet rund um Oberthal zu erkunden. Wichtiges Bindeglied der Erschließung stellt der Saar-Nahe-Höhenradweg vom Bostalsee kommend dar, welcher nördlich von Oberthal auf den „Wendelinus- Radweg“ trifft. Aufgabenstellung war, eine direkte Verbindung vom Wendelinus-Radweg über die Imweiler Wies nach Oberhal zu schaffen, und somit dessen Ortskern langfristig zu beleben. Die „Imweiler Wies“ wird mit Errichtung eines Hochwasserdammes und Verlegung des Imweiler Baches landschaftlich aufgewertet und erlebbar gemacht. Kern des Projektes ist ein 900m langer Fuß- und Radweg. Prägendes Element ist das mit dem Weg verlaufende „Rote Band“, welches auf die Landschafts- und Ortshistorie zu verstehen ist (ehemals abgebauter roter Rötelstein). Eine Baumachse aus Traubenkirschen dient als fernwirksame Orientierung. Durch zwei taschenförmige Aufweitungen wird der Landschaftsraum zum Treff- und Anlaufpunkt für Jung und Alt. Hier erhebt sich das Rote Band und formt so dynamische Sitzgelegenheiten, die Wiesenschaukel und das „Landschaftfsfenster“. Die Sonnentreppe, ein mehrfach abgestuftes Holzplateau, bietet zudem Raum für rastende Besucher. Das Naturerlebnis “Imweiler Wies” mündet in der neuen grünen Mitte Oberthals, welche durch die Realisierung eines Wassergartens in Verbindung mit technischen Hochwasserschutzmaßnahmen zu einem Gesamtgefüge beiträgt. Applikationen wie die 20m lange Bürger- und Vereinsvitrine oder das Holzdeck über dem Wassergarten runden das Gesamtbild ab.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Anerkennung in der Kategorie gebaut
Walle/Überseestadt, Stadtgemeinde Bremen, Bremen
Bundespreis Stadtgrün/Hergen Schimpf
Beschreibung
Die Überseestadt ist eine Hafenkonversionsfläche in Bremen und entwickelt sich zu einem neuen Stück Stadt an der Weser. Künftig werden dort 24.000 Menschen arbeiten und 12.000 Menschen wohnen. Der Strandpark Waller Sand ist seit 2019 Teil ihrer Freiraum-Infrastruktur. Er verwandelte die ehemals graue Hochwasserschutz-Infrastruktur in eine grüne: Mit Blick auf den Klimawandel musste der Hochwasserschutz ertüchtigt werden. Bremen realisierte dabei einen zukunftsfähigen und urbanen Hochwasserschutz, der die Erlebbarkeit des Wassers fördert und die sonst oft übliche Trennung von Stadt und Wasser vermeidet. Statt eines technischen Bauwerks entstand im Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ ein nutzungsoffener und atmosphärischer Freiraum, der dem angrenzenden Hafen, der Natur und dem Leben im neuen Ortsteil gerecht wird. Innovative, multifunktionale Lösungen verwandelten die Sandvorschüttung in eine nutzbare Dünenlandschaft und machten aus der Hochwasserschutz-Spundwand eine 350 m lange Bank. So sind ein 30.000 m² großer Stadtstrand mit extensiver Parklandschaft, Sport- und Spielangeboten, ein urbaner Boulevard und eine Molenpromenade entstanden.
Der Waller Sand verbesssert auch das Freiraumangebot in den angrenzenden Quartieren, die aufgrund der Hafenanlagen bislang kaum Zugang zur Weser hatten. Damit ist die Hoffnung verbunden, der Waller Sand möge die neue Überseestadt und die benachbarten Stadtteile Gröpelingen und Walle näher zusammenbringen. Das geschieht z. B. über eine Fähre und neue ÖPNV-Verbindungen.
Auf die Auswirkungen des Klimawandels reagiert das Projekt mit ressourcenschonendem, nachhaltigem und sozialem Bauen. Materialienrecycling, kurze Transportwege und ein Biodiversität förderndes Pflanzkonzept trugen zur CO2-Reduktion und Klimaverbesserung bei. Mit dem Waller Sand ist ein zukunftsweisender Ort entstanden, der auf beispielhafte Weise zur Profilierung Bremens als Stadt am Fluss beiträgt.
Steckbrief der Einreichung (PDF)
Jurybewertung
Das Projekt sticht heraus durch die kreative Verknüpfung einer funktionsfähigen Hochwasserschutzanlage mit einem gestalterisch hochwertigen und nutzbaren Aufenthaltsort für die Stadtbevölkerung. Dahinter steckt eine Disziplinen überwindende, integrative Planung und Umsetzung von Wasserbau und Landschaftsarchitektur unter Einbeziehung der Bevölkerung und der Hafenwirtschaft. Die Jury würdigt insbesondere die schlichte, multifunktionale und gelungene Gestaltung mit geringem Mitteleinsatz. Sie bezeugt die integrierte Entwicklung im Zusammenspiel der unterschiedlichen Disziplinen. Das Projekt ist Vorbild für die Verzahnung von Stadtgrün und Stadtentwicklung im Klimawandel. Das gebaute Ergebnis ist Inspiration für Städte mit ähnlichen Herausforderungen, in Küsten- und Flussnähe.